Bis heute konnten noch nicht alle Einzelheiten in der Pathophysiologie der Multiplen Sklerose restlos aufgeklärt werden. Doch eine wichtige Erkenntnis konnte gewonnen werden: je früher man in die Erkrankung eingreift, umso besser ist es. Ein Schwerpunkt der Forschung liegt daher auf dem Verständnis der Mechanismen der Neurodegeneration und im Verlauf dann der Entwicklung neuroprotektiver Strategien.
Die Multiple Sklerose (MS) ist eine Autoimmunerkrankung, die in der Peripherie – also beispielsweise den Lymphknoten – startet. Dort kommt es zu einer Fehlregulation unterschiedlicher Immunzellen. Diese Fehlregulation führt zu einer Infiltration der aktivierten T-Zellen ins ZNS und schlussendlich zum Beginn der MS [1]. Daraufhin siedeln sich bestimmte Immunzellen ab und es werden kontinuierlich Entzündungsmediatoren freigesetzt, sodass eine Schädigung der Nervenzellen die Folge ist. Im späteren Verlauf der Erkrankung nimmt die Anzahl der Entzündungszellen im ZNS zugunsten einer «organisierten» Entzündungsreaktion ab. Diese treibt den Untergang der Nervenzellen und die Demyelinisierung weiter voran. Während der Erkrankung zeigen sich im Gehirn eine kortikale Atrophie, eine Atrophie der weissen ebenso wie der grauen Substanz sowie des Cerebellums.
Es wird davon ausgegangen, dass zu Beginn der MS eine chronische Entzündung des ZNS vorliegt. Dadurch werden unterschiedliche reaktive Spezies, wie Stickstoff bzw. Sauerstoff, Glutamat oder Zytokine freisetzt. Dies führt neben einem oxidativen Stress zu einer Schädigung der Mitochondrien und einer Demyelinisierung. Ein Energiedefizit und eine Umverteilung der Ionenkanäle sind die Folge. Es kommt zu einer Ionen-Dysbalance sowie zu einem Calcium und Natrium Überschuss. Die Aktivierung von Abbauenzymen sowie das Anschwelle der Zellen trägt letztendlich dann zur neuroaxonalen Schädigung bei [2]. Im Überblick kann man sagen, dass eine kontinuierliche mikrogliale Aktivität und meningeale Entzündung mit einer neuronalen Verletzung der weissen und grauen Substanz einhergehen. Es besteht ein Ungleichgewicht zwischen Stressorbelastung und neuronaler Pufferkapazität. Der Ausgleich über antientzündliche Therapiestrategien und damit der Verminderung der Stressorbelastung ist eine Möglichkeit, die aktuell auch intensiv verfolgt wird. Doch die Stärkung der protektiven Pfade sollte nicht ausser Acht gelassen werden. Inzwischen konnte belegt werden, dass eine Modulierung der Immunreaktion in den frühen Phasen der MS von Vorteil ist. Entsprechend besteht ein hoher klinischer Bedarf an neuroprotektiven Strategien mit dem Ziel, die neuronale Widerstandsfähigkeit gegenüber entzündlichen Herausforderungen zu stärken.
Auf den Spuren der Neurodegeneration
Mit Hilfe einer Einzelzellsequenzierung konnte beobachtet werden, dass die meisten differentiell exprimierten Gene bei MS-Patienten in exzitatorischen Neuronen zu finden sind [3]. Dies triggert wiederum u.a. eine Neurotransmitter Sekretion, einen Energie Metabolismus, die Mitochondriale Permeabilität sowie eine Reaktion gegen ungefaltete Proteine. Einen Ansatzpunkt für eine mögliche Rebalancierung bietet nun die Glutamat Exzitotoxizität. Denn die Glutamat-Rezeptor Gene sind mit schwereren MS-Verläufen assoziiert [4]. Wie sich gezeigt hat, ist vor allem der GRM8 ist ein potenter Modulator der Glutamat Exzitotoxizität und damit potentiell neuroprotektiv. Denn eine GRM8-Aktivität begrenzt die toxische zytosolische und nukleare Kalziumakkumulation. Entsprechend könnte eine GRM8-Aktivierung ein wirksamer therapeutischer Ansatz sein, um die neuronale Widerstandsfähigkeit zu erhöhen und der entzündlichen Neurodegeneration bei MS entgegenzuwirken.
Literatur:
- Dendrou CA, Fugger L, Friese MA: Nat Rev Immunol 2015; 15: 545–558.
- Friese MA, et al.: Nat Rev Neurol. 2014; 10: 225–238.
- Schirmer L, et al.: Nature 2019; 573: 75–82.
- Woo MS, et al.: J Exp Med. 2021; 218(5): e20201290.
InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2022; 20(1): 32
Autoren
- Leoni Burggraf
Publikation
- INFO NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE

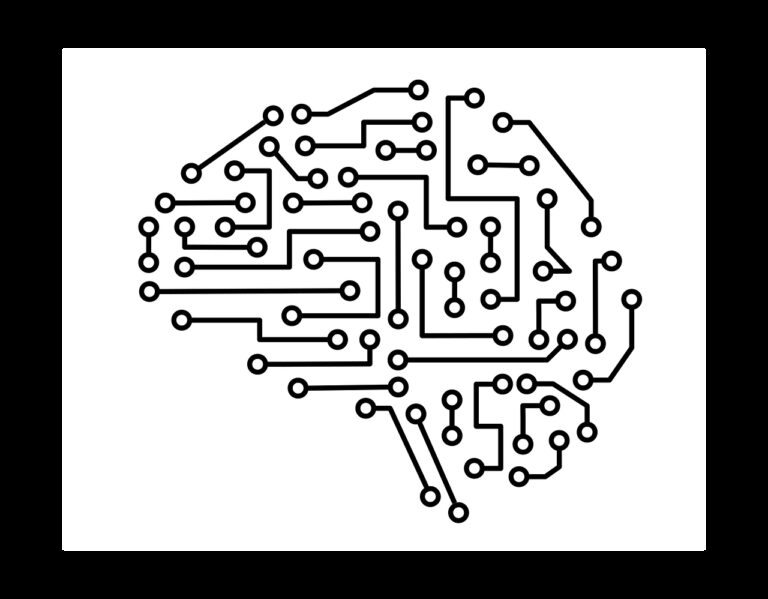


Comments are closed.