Chronische Niereninsuffizienz kann zu schwerwiegenden Veränderungen der Knochendichte und -mineralisation führen. Diese Veränderungen werden unter dem Begriff CKD-MBD (Chronic Kidney Disease – Mineral and Bone Disorder) zusammengefasst. In diesem Artikel, der auf HAUSARZT PRAXIS basiert, erfahren Sie, wie Osteoporose bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung behandelt werden kann und welche aktuellen Empfehlungen und Studienergebnisse es dazu gibt.
Wie beeinflusst eine chronische Nierenerkrankung die Knochengesundheit?
Chronische Nierenerkrankungen (CKD, Chronic Kidney Disease) führen häufig zu Störungen im Mineral- und Knochenhaushalt. Diese Veränderungen werden als CKD-MBD bezeichnet. CKD-MBD umfasst sowohl eine gestörte Knochendichte (die Knochen werden poröser und brüchiger) als auch eine veränderte Mineralisation (Einlagerung von Mineralstoffen wie Kalzium und Phosphat in den Knochen). Zu den klassischen Risikofaktoren für Knochenbrüche zählen Alter, geringes Körpergewicht und Bewegungsmangel. Bei CKD-Patienten kommen jedoch zusätzliche, krankheitsspezifische Faktoren hinzu: Der Stoffwechsel von Phosphat, Kalzium, FGF-23 (Fibroblast Growth Factor 23), Parathormon (PTH) und Vitamin D ist häufig gestört. Diese Veränderungen erhöhen das Risiko für Knochenbrüche deutlich.
Die KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) hat 2017 eine eigene Leitlinie für CKD-MBD veröffentlicht, die weiterhin aktuell ist. Besonders in den CKD-Stadien 3–5D (fortgeschrittene Niereninsuffizienz und Dialysepflicht) ist das Risiko für Knochenbrüche erhöht. Daher empfiehlt die KDIGO-Leitlinie, bei diesen Patienten eine Knochendichtemessung mittels DXA (Dual-Röntgen-Absorptiometrie, eine spezielle Röntgenuntersuchung zur Messung der Knochendichte) durchzuführen. So kann das individuelle Frakturrisiko besser eingeschätzt und die Therapie gezielt angepasst werden.
Die Behandlung der Osteoporose bei CKD-Patienten ist komplex, da sowohl klassische Risikofaktoren als auch die CKD-spezifischen Störungen berücksichtigt werden müssen. Ziel ist es, Knochenbrüche zu verhindern und die Lebensqualität zu verbessern. Dabei spielen sowohl Medikamente als auch Veränderungen des Lebensstils eine wichtige Rolle.
Therapieziele und wichtige Maßnahmen bei CKD-MBD
Zu den wichtigsten Therapiezielen bei CKD-MBD zählen:
- Hyperkalzämie (zu hohe Kalziumwerte im Blut) vermeiden
- Erhöhte Phosphatwerte auf den Normalbereich senken
- PTH (Parathormon) im Normbereich bis leicht erhöht halten
- Vitamin-D-Mangel vermeiden oder behandeln
Diese Ziele helfen, das Risiko für Knochenbrüche zu senken und Komplikationen zu vermeiden. Die Therapie muss individuell an die Bedürfnisse des Patienten angepasst werden. Neben der medikamentösen Behandlung sind auch Lebensstilfaktoren wie ausreichende Bewegung, eine ausgewogene Ernährung und der Verzicht auf Rauchen und übermäßigen Alkoholkonsum wichtig.
Für die Frakturprävention stehen verschiedene Medikamente zur Verfügung. In den CKD-Stadien 1–3 (leichte bis mittelschwere Nierenschwäche) sind viele dieser Medikamente sicher und wirksam. In den fortgeschrittenen Stadien 4–5D (schwere Nierenschwäche bis Dialyse) ist die Datenlage weniger eindeutig, und die Therapie muss besonders sorgfältig abgewogen werden. Die individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung ist hier entscheidend.
Auch nicht-medikamentöse Maßnahmen sind wichtig: Dazu gehören regelmäßige körperliche Aktivität, Sturzprävention (zum Beispiel durch Anpassung der Wohnumgebung), eine ausreichende Kalzium- und Vitamin-D-Zufuhr sowie die Behandlung von Begleiterkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck.
Kalzium und Vitamin D: Bedeutung und richtige Anwendung
Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung von sekundärem Hyperparathyreoidismus (SHPT, eine Überfunktion der Nebenschilddrüsen als Folge der Nierenerkrankung) ist bei CKD-Patienten besonders wichtig. Bereits ab CKD-Stadium 3 (deutliche Einschränkung der Nierenfunktion) treten häufig erhöhte PTH-Werte und abnorme Kalzium- und Phosphatwerte auf. Studien zeigen, dass 40–82 % der Patienten im CKD-Stadium 3b/4 an SHPT leiden. Ein hoher PTH-Wert ist ein unabhängiger Risikofaktor für Knochenbrüche, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und eine erhöhte Sterblichkeit.
Vitamin-D-Mangel ist bei CKD-Patienten sehr häufig, insbesondere wenn gleichzeitig eine Proteinurie (erhöhte Eiweißausscheidung im Urin) vorliegt. Ein Vitamin-D-Mangel erhöht das Risiko für Knochenbrüche zusätzlich. Deshalb sollte eine Vitamin-D-Supplementierung (Zufuhr von Vitamin D als Medikament oder Nahrungsergänzungsmittel) frühzeitig im Verlauf der Nierenerkrankung begonnen werden. Für CKD-Patienten wird eine tägliche Zufuhr von 800 IE (Internationale Einheiten) Vitamin D empfohlen, wobei die Dosis individuell angepasst werden kann, um den Zielwert für 25-OH-Vitamin D zu erreichen.
Die Kalziumzufuhr muss bei CKD-Patienten besonders sorgfältig gesteuert werden. Eine zu hohe Kalziumzufuhr kann schädlich sein, vor allem bei bereits bestehenden hohen Kalziumwerten (Hyperkalzämie), niedrigen PTH-Werten, adynamischen Knochen (Knochen mit geringer Stoffwechselaktivität), gleichzeitiger Warfarin-Therapie (ein Gerinnungshemmer) oder bestehenden Gefäßverkalkungen. Studien zeigen, dass eine moderate Kalziumzufuhr (bis zu 1000 mg/Tag) in Kombination mit einer antiresorptiven Therapie (siehe unten) die Knochendichte verbessert, ohne das Risiko für Gefäßverkalkungen oder arterielle Steifigkeit zu erhöhen.
Die regelmäßige Kontrolle der Kalzium-, Phosphat- und Vitamin-D-Spiegel ist bei CKD-Patienten unerlässlich. Nur so kann eine Über- oder Unterversorgung rechtzeitig erkannt und die Therapie entsprechend angepasst werden. Die Zusammenarbeit zwischen Hausarzt, Nephrologe (Nierenspezialist) und ggf. Endokrinologe (Hormonspezialist) ist hierbei besonders wichtig.
Antiresorptiva: Bisphosphonate und Denosumab im Überblick
Antiresorptiva sind Medikamente, die den Knochenabbau hemmen und so das Risiko für Knochenbrüche senken. Zu den wichtigsten Vertretern gehören die Bisphosphonate und Denosumab. Studien zeigen, dass Bisphosphonate das Frakturrisiko auch noch Jahre nach Beendigung der Therapie senken können. Denosumab ist ein weiteres Antiresorptivum, das vor allem bei postmenopausalen Frauen mit normaler Nierenfunktion sowie bei CKD-Patienten in den Stadien 1–3 über mindestens 10 Jahre wirksam ist.
In den CKD-Stadien 4–5D besteht für Bisphosphonate jedoch eine relative Kontraindikation (Gegenanzeige), da die Ausscheidung über die Nieren eingeschränkt ist und sich das Medikament im Körper anreichern kann. Es gibt Berichte über akutes Nierenversagen nach Bisphosphonat-Therapie in diesen Stadien. Bei einer eGFR (geschätzte glomeruläre Filtrationsrate, Maß für die Nierenfunktion) unter 30 ml/min/1,73 m2 ist die Anwendung von Bisphosphonaten in den meisten Ländern nicht zugelassen.
Denosumab wird nicht über die Nieren ausgeschieden und beeinflusst die Nierenfunktion nicht negativ. Daher ist es auch in den CKD-Stadien 4–5D nicht kontraindiziert. Beobachtungsstudien und kleinere randomisierte kontrollierte Studien (RCTs) zeigen, dass Denosumab die Knochendichte deutlich steigern kann, ohne das kardiovaskuläre Risiko zu erhöhen – auch nicht bei Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz. Allerdings kann es nach dem Absetzen von Denosumab zu einem sogenannten Rebound-Effekt kommen, bei dem das Risiko für Hypokalzämie (zu niedrige Kalziumwerte im Blut) steigt. Seltene, aber mögliche Komplikationen unter Antiresorptiva sind atypische Femurfrakturen (ungewöhnliche Oberschenkelbrüche) und Osteonekrose des Kiefers (Absterben von Kieferknochen). Diese treten bei CKD-Patienten jedoch nicht häufiger auf als in der Allgemeinbevölkerung.
Die Entscheidung für oder gegen ein Antiresorptivum sollte immer individuell getroffen werden. Dabei müssen das Frakturrisiko, die Nierenfunktion, Begleiterkrankungen und mögliche Nebenwirkungen sorgfältig abgewogen werden. Eine enge Überwachung der Kalziumspiegel ist insbesondere unter Denosumab wichtig, um Komplikationen frühzeitig zu erkennen.
Osteoanabolika und Romosozumab: Aufbauende Therapien für den Knochen
Osteoanabolika sind Medikamente, die den Knochenaufbau fördern. Zu den wichtigsten Vertretern zählen Teriparatid und Abaloparatid. Sie werden vor allem bei postmenopausalen Frauen mit hohem Frakturrisiko eingesetzt. Studien zeigen, dass diese Medikamente sowohl bei Patienten mit normaler Nierenfunktion als auch bei CKD-Stadien 1–3 und normalen PTH-Spiegeln ähnlich wirksam sind. Unter Teriparatid kann es bei CKD-Patienten häufiger zu Hyperkalzämie und Hyperurikämie (erhöhte Harnsäurewerte) kommen, jedoch ohne vermehrtes Auftreten von Nierensteinen oder Gicht.
Die Behandlung mit Osteoanabolika ist bei CKD-Patienten in den Stadien 1–3 mit hohem Frakturrisiko und ohne erhöhtes endogenes PTH sicher und wirksam, wenn eine engmaschige Überwachung erfolgt. Für die Stadien 4–5 gibt es nur begrenzte Daten, aber kleinere Studien deuten auf einen Anstieg der Knochendichte hin. Aufgrund der eingeschränkten Datenlage sollte die Anwendung in diesen Stadien individuell und unter besonderer Vorsicht erfolgen.
Romosozumab ist ein weiteres Medikament, das sowohl den Knochenaufbau fördert als auch den Knochenabbau hemmt. Eine Beobachtungsstudie bei Hämodialysepatienten zeigte, dass eine einjährige Behandlung mit Romosozumab die Knochendichte verbessert, ohne die Rate kardiovaskulärer Ereignisse zu erhöhen. Allerdings waren viele Patienten zuvor mit Bisphosphonaten behandelt worden. Post-hoc-Analysen aus Zulassungsstudien zeigen, dass die Wirksamkeit und Sicherheit von Romosozumab bei unterschiedlichen Nierenfunktionswerten ähnlich ist wie bei Alendronat oder Placebo. Dennoch gab es in der Romosozumab-Gruppe eine zahlenmäßig höhere Rate unerwünschter kardiovaskulärer Ereignisse, weshalb weitere Sicherheitsdaten notwendig sind – insbesondere, da CKD-Patienten ohnehin ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko haben.
Wichtig zu wissen: Bei Patienten mit CKD im Stadium 4–5D kann Romosozumab eine ausgeprägte Hypokalzämie verursachen. Daher ist eine sorgfältige Überwachung der Kalziumwerte während der Therapie unerlässlich.
Weitere Therapieoptionen: Hormontherapie, SERMs, Kalzimimetika und Parathyreoidektomie
Die Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse (ein hormonelles Steuerungssystem, das unter anderem die Sexualhormone reguliert) ist bei CKD-Patienten oft gestört. Das führt dazu, dass eine frühe Menopause oder ein Hypogonadismus (Mangel an Sexualhormonen) häufiger auftreten. Die Hormonersatztherapie (HRT) könnte daher eine Rolle in der Behandlung der Osteoporose bei CKD spielen. Allerdings gibt es bisher nur wenige Daten aus randomisierten kontrollierten Studien (RCTs), sodass keine eindeutige Empfehlung für HRT oder selektive Estrogenrezeptormodulatoren (SERMs) bei CKD-Patienten ausgesprochen werden kann. Zudem ist das kardiovaskuläre Risiko unter HRT und SERMs erhöht, was bei CKD-Patienten besonders kritisch zu bewerten ist.
Kalzimimetika wie Cinacalcet sind Medikamente, die den Kalziumspiegel im Blut senken, indem sie die Aktivität der Nebenschilddrüsen hemmen. Für Cinacalcet gibt es Hinweise aus Post-hoc-Analysen, dass es in den CKD-Stadien 4–5D das Frakturrisiko senken könnte. Allerdings fehlen hochwertige Studien, die diesen Effekt eindeutig belegen. Bei der Anwendung von Cinacalcet sollte die Kalziumbilanz im Auge behalten werden, insbesondere bei Patienten mit hohem Frakturrisiko.
Eine Parathyreoidektomie (operative Entfernung der Nebenschilddrüsen) kann bei Patienten mit primärem oder sekundärem Hyperparathyreoidismus zu einer deutlichen Steigerung der Knochendichte führen. Besonders bei Patienten mit Osteoporose ist dieser Effekt ausgeprägt. Studien zeigen, dass die Parathyreoidektomie das Frakturrisiko bei Hämodialysepatienten senkt. Allerdings steigt das Risiko für Krankenhausaufenthalte im ersten Jahr nach der Operation deutlich an, weshalb die Entscheidung für diesen Eingriff sorgfältig abgewogen werden sollte.
Praktische Empfehlungen und Take-Home-Messages für Patienten
Für Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz und Osteoporose gelten folgende wichtige Empfehlungen:
- Kalzium und Vitamin D sind auch bei CKD-Patienten zentrale Bausteine der Frakturprävention und der Behandlung bzw. Vorbeugung eines sekundären Hyperparathyreoidismus. Die Dosierung von Kalzium sollte jedoch individuell angepasst werden, um Nebenwirkungen zu vermeiden. In den CKD-Stadien 4–5D ist die Studienlage eingeschränkt, daher ist besondere Vorsicht geboten.
- Antiresorptive Medikamente wie Bisphosphonate und Denosumab sind in den CKD-Stadien 1–3 sicher und wirksam. In den Stadien 4–5D kann eine Anwendung sinnvoll sein, sollte aber individuell und unter sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung erfolgen, da direkte Beweise für die Frakturprävention in dieser Patientengruppe noch fehlen.
- Osteoanabolika sind bei CKD-Patienten im Stadium 1–3 mit hohem Frakturrisiko und ohne erhöhtes endogenes PTH sicher und wirksam. Bei Patienten in den Stadien 4–5 und Anzeichen von adynamischen Knochen können PTH-Analoga zur Frakturreduktion in Erwägung gezogen werden. Wegen der begrenzten Datenlage ist hier besondere Vorsicht geboten.
- Romosozumab kann bei postmenopausalen Frauen zu einem deutlichen Anstieg der Knochendichte führen. Für CKD-Patienten gibt es jedoch noch keine ausreichenden Studiendaten, die eine Wirksamkeit eindeutig belegen. Zudem besteht das Risiko einer Hypokalzämie, insbesondere in den Stadien 4–5D.
- Für Hormontherapie und SERMs gibt es bei CKD-Patienten derzeit keine eindeutige Empfehlung, da die Datenlage begrenzt ist und das kardiovaskuläre Risiko erhöht sein kann.
- Bei manchen Patienten mit primärem oder sekundärem Hyperparathyreoidismus kann eine Parathyreoidektomie die Knochendichte steigern und das Frakturrisiko senken. Allerdings ist das Risiko für Komplikationen nach der Operation erhöht, weshalb die Entscheidung individuell getroffen werden sollte.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Behandlung der Osteoporose bei chronischer Niereninsuffizienz eine sorgfältige individuelle Abwägung erfordert. Die enge Zusammenarbeit zwischen Patient, Hausarzt und Fachärzten ist entscheidend für eine erfolgreiche Therapie. Regelmäßige Kontrollen der Knochendichte, der Laborwerte und der Begleiterkrankungen helfen, das Risiko für Knochenbrüche zu senken und die Lebensqualität zu erhalten.
Mirjam Peter, M.Sc.
Quellen
- Haarhaus M, et al.: Management of fracture risk in CKD-traditional and novel approaches. Clin Kidney J 2022; 16(3): 456–472.
- Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD-MBD Update Work Group. KDIGO 2017 Clinical practice guideline update for the diagnosis, evaluation, prevention, and treatment of chronic kidney disease-mineral and bone disorder (CKD-MBD). Kidney Int Suppl 2017; 7: 1–59.
- Cejka D, et al.: Diagnose und Therapie der Osteoporose bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz, Gemeinsame Leitlinie der ÖGKM/ÖGPMR/ÖGN. Wien Med Wochenschr 2022 Dec 21.
- Levin A, et al.: Kidney Int 2007; 71: 31–38.
- Geng S, et al.: Osteoporosis International 2019; 30: 2019–2025.
- Giannini S, et al.: Endocrine 2018; 59: 242–259.
- Spiegel DM, Brady K: Kidney Int 2012; 81: 1116–1122.
- Iseri K, et al.: J Bone Miner Res 2019; 34: 1014–1024.
- Bone HG, et al.: Lancet Diabetes Endocrinol 2017; 5: 513–523.
- Broadwell A, et al.: J Clin Endocrinol Metab 2021; 106: 397–409.
- Evenepoel P, et al.: Nephrol Dial Transplantat 2021; 36: 42–59
- Haarhaus M, Evenepoel P: Kidney Int 2021; 100: 546–558.
- Dennison EM, et al.: Osteoporosis International 2019; 30: 1733–1743.
- Bilezikian JP, et al.: Curr Med Res Opin 2019; 35: 2097–2102.
- Miller PD, et al.: Osteoporosis International 2007; 18: 59–68.
- Sato M, et al.: J Bone Miner Metab 2021; 39: 1082–1090.
- Miller PD, et al.: J Bone Miner Res 2022; 37: 1437–1445.
- Saag KG, et al.: N Engl J Med 2017; 377: 1417–1427.
- Lewiecki EM, et al.: J Bone Miner Res 2019; 34: 419–428.
- Hsu CP, et al.: J Clin Pharmacol 2022; 62: 1132–1141.
- Moe SM, et al.: J Am Soc Nephrol 2015 ;26: 1466–1475.
- VanderWalde LH, Liu IL, Haigh PI: World J Surg 2009; 33: 406–411.
- Chou FF, et al.: Arch Surg 2001; 136: 1064–1068.
- Rudser KD, et al.: J Am Soc Nephrol 2007; 18: 2401–2407.
- Ishani A, et al.: Clin J Am Soc Nephrol 2015; 10: 90–97.
- Bover J, et al.: J Nephrol 2017; 30: 677–687.


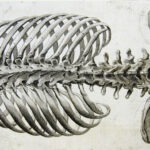

Comments are closed.