Die rheumatoide Arthritis (RA) ist die häufigste entzündlich-rheumatische Gelenkerkrankung und betrifft Frauen deutlich häufiger als Männer. Dieser Artikel basiert auf HAUSARZT PRAXIS und erklärt, warum geschlechtsspezifische Unterschiede bei der RA wichtig sind, wie sie sich auf Symptome, Krankheitsverlauf und Therapie auswirken und warum eine individuelle Behandlung für Männer und Frauen entscheidend ist. Erfahren Sie, wie aktuelle Studien helfen, die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit RA zu verbessern.
Warum sind Geschlechterunterschiede bei der rheumatoiden Arthritis wichtig?
Die rheumatoide Arthritis (RA) ist eine chronische, entzündliche Erkrankung der Gelenke, die zu den Autoimmunerkrankungen zählt. Das bedeutet, dass das Immunsystem die eigenen Gelenke angreift und Entzündungen verursacht. Frauen sind etwa zwei- bis dreimal häufiger betroffen als Männer. Die genauen Ursachen für diesen sogenannten Geschlechterbias (Unterschiede zwischen den Geschlechtern) sind noch nicht vollständig geklärt. Es wird angenommen, dass immunologische (das Immunsystem betreffende), hormonelle (z.B. Sexualhormone wie Östrogen und Testosteron) und genetische Faktoren eine Rolle spielen. Männer erkranken zwar seltener an Autoimmunerkrankungen wie RA, haben aber häufiger maligne Erkrankungen (bösartige Tumore). Die Forschung zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Rheumatologie steckt noch in den Anfängen, aber es ist bereits klar, dass solche Unterschiede für die Diagnose, Therapie und Prognose der RA von großer Bedeutung sind. Um eine möglichst individuelle und effektive Behandlung zu ermöglichen, müssen diese geschlechtsspezifischen Aspekte stärker berücksichtigt werden.
Studien zeigen, dass sich Frauen und Männer mit RA in vielerlei Hinsicht unterscheiden: vom Alter bei der Diagnosestellung, über den Verlauf der Erkrankung, das Erleben von Schmerzen und Müdigkeit (Fatigue), bis hin zu Begleiterkrankungen (Komorbiditäten) und der Nutzung des Gesundheitssystems. Auch die Verteilung bestimmter Autoantikörper (Abwehrstoffe gegen körpereigene Strukturen) unterscheidet sich zwischen den Geschlechtern. Diese Erkenntnisse helfen, die Versorgung und Lebensqualität von Patientinnen und Patienten mit RA gezielt zu verbessern.
Krankheitsverlauf und Therapie: Unterschiede zwischen Frauen und Männern
Der Verlauf der rheumatoiden Arthritis ist entscheidend für die langfristige Gesundheit der Betroffenen. Eine frühzeitige Diagnose und der rasche Beginn einer effektiven Therapie mit sogenannten DMARDs (Disease-Modifying Antirheumatic Drugs, also krankheitsmodifizierende antirheumatische Medikamente) können Langzeitschäden wie Gelenkzerstörung und Funktionsverlust verhindern. Moderne Therapiekonzepte wie die “Treat-to-target” (T2T)-Strategie zielen darauf ab, die Krankheitsaktivität so weit wie möglich zu senken und das bestmögliche Behandlungsergebnis zu erreichen. Dabei werden heute häufig auch Biologika (biotechnologisch hergestellte Medikamente, die gezielt in das Immunsystem eingreifen) eingesetzt.
Eine schwedische Studie mit 844 Patientinnen und Patienten mit früher RA zeigte, dass Frauen bei der Diagnosestellung im Durchschnitt jünger waren als Männer (54,4 vs. 60,3 Jahre). Besonders bei Patientinnen unter 40 Jahren war das Verhältnis von Frauen zu Männern sogar 5:1. Frauen hatten zudem im Median niedrigere Entzündungswerte (CRP 17 vs. 26 mg/l), aber einen höheren Krankheitsaktivitätsscore (DAS28: 5,2 vs. 5,0) und einen schlechteren Funktionsscore (HAQ-Score: 1,0 vs. 0,75). Nach zwei Jahren war die Krankheitsaktivität bei Frauen weiterhin höher (DAS28: 3,6 vs. 3,1) und die Funktionalität schlechter (HAQ-Score: 0,5 vs. 0,25). Im Röntgenbild (Larsen-Score zur Beurteilung von Gelenkzerstörung) gab es jedoch keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Frauen möglicherweise ein schlechteres Ansprechen auf die Therapie haben, was zu einer anhaltend höheren Krankheitsaktivität führt.
Diese Erkenntnisse verdeutlichen, wie wichtig es ist, geschlechtsspezifische Faktoren bei der Behandlung der RA zu berücksichtigen. Ein individuell angepasstes Therapiekonzept kann helfen, die Lebensqualität und das langfristige Outcome (Ergebnis) für Frauen und Männer mit RA zu verbessern.
Schmerz, Fatigue und das Erleben der Erkrankung: Wie Frauen und Männer RA unterschiedlich wahrnehmen
Das subjektive Erleben der Erkrankung ist bei RA sehr unterschiedlich und wird von vielen Faktoren beeinflusst. Frauen berichten im Vergleich zu Männern häufiger über stärkere Schmerzen. Dies liegt unter anderem daran, dass Frauen eine höhere Schmerzempfindlichkeit haben. Fragebögen zur Schmerzerfassung zeigen daher bei Frauen mit RA meist höhere Werte. Interessanterweise stimmen diese Angaben nicht immer mit objektiven Entzündungszeichen überein, die beispielsweise durch eine funktionelle Magnetresonanztomographie (MRT) sichtbar gemacht werden können.
Ein Grund für die erhöhte Schmerzempfindlichkeit bei Frauen sind die Sexualhormone: Testosteron (männliches Sexualhormon) erhöht beispielsweise die Schmerzschwelle, während Östrogene (weibliche Sexualhormone) die Schmerzwahrnehmung beeinflussen. Frauen besitzen zudem mehr Schmerzrezeptoren (Empfangsstellen für Schmerzsignale) und diese sind anders ausgeprägt als bei Männern, insbesondere im Hinblick auf Opioidrezeptoren (Bindungsstellen für körpereigene und medikamentöse Schmerzmittel). Genetische Studien zeigen, dass bestimmte Gene, die an akuten und chronischen Schmerzen beteiligt sind, geschlechtsspezifisch unterschiedlich aktiv sein können. Auch Immunzellen, insbesondere T-Zellen (eine Art weißer Blutkörperchen, die bei Entzündungen eine Rolle spielen), zeigen qualitative Unterschiede zwischen den Geschlechtern bei chronischen Schmerzen.
Darüber hinaus beeinflussen auch äußere Faktoren wie Erwartungen, kulturelle Unterschiede, frühere Schmerzerfahrungen und Umweltstress die Schmerzwahrnehmung. Stereotype und Überzeugungen über Schmerz können dazu führen, dass Frauen und Männer ihre Beschwerden unterschiedlich wahrnehmen und mitteilen. All diese Faktoren machen deutlich, wie komplex das Schmerzempfinden bei RA ist und warum eine individuelle, geschlechtsspezifische Betrachtung so wichtig ist.
Neben Schmerzen spielt auch Fatigue (ausgeprägte Müdigkeit und Erschöpfung) eine große Rolle im Alltag von Menschen mit RA. In einer Studie zu geschlechtsspezifischen Unterschieden bei Fatigue wurden 228 Frauen und Männer mit RA untersucht. Es zeigte sich, dass weibliche Patientinnen an Tagen mit vielen positiven Erlebnissen weniger müde waren, am nächsten Tag jedoch mehr Müdigkeit verspürten (sogenannter “Hangover-Effekt”). Bei Männern hatte dies keinen Einfluss. Negative Ereignisse führten bei beiden Geschlechtern zu erhöhter Müdigkeit am selben und am nächsten Tag. Daten aus der Kerndokumentation der regionalen kooperativen Rheumazentren in Deutschland mit 3685 Frauen und 1378 Männern bestätigen, dass Frauen häufiger über moderate bis starke Fatigue und Schmerzen berichten (57 % der Frauen vs. 45 % der Männer).
Diese Unterschiede im Krankheitserleben sollten bei der Betreuung und Therapie von RA-Patientinnen und -Patienten unbedingt beachtet werden, um individuell passende Unterstützungsangebote zu schaffen.
Komorbiditäten: Begleiterkrankungen bei RA und ihre geschlechtsspezifischen Besonderheiten
Komorbiditäten (Begleiterkrankungen) beeinflussen nicht nur die Auswahl der antirheumatischen Therapie, sondern auch das Ansprechen auf die Behandlung und den weiteren Verlauf der RA. Eine Analyse von Krankenkassendaten aus Deutschland aus dem Jahr 2015 zeigte, dass neben kardiovaskulären Risikofaktoren (Herz-Kreislauf-Erkrankungen) vor allem Arthrosen (44 %), Depressionen (32 %) und Osteoporose (26 %) zu den häufigsten Begleiterkrankungen bei RA zählen. Frauen leiden häufiger an Depressionen, Osteoporose, Arthrosen und einer Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion), während Männer häufiger von koronarer Herzerkrankung, Diabetes, Herzrhythmusstörungen und anderen Gefäßerkrankungen betroffen sind.
Eine Übersichtsarbeit von Albrecht et al. betont, dass bei Männern mit RA besonders auf die Kontrolle kardiovaskulärer Risikofaktoren geachtet werden sollte, da diese bei ihnen häufiger auftreten. Bei älteren Frauen mit RA sind kardiovaskuläre Ereignisse (wie Herzinfarkt oder Schlaganfall) die häufigste Todesursache. Die Osteoporose-Prophylaxe (Vorbeugung von Knochenschwund) ist nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer mit RA und entsprechenden Risikofaktoren (z.B. Glukokortikoid-Therapie, also Behandlung mit Kortison) wichtig. Die bei Frauen häufig auftretende Hypothyreose kann durch regelmäßige Kontrolle der Schilddrüsenfunktion frühzeitig erkannt und behandelt werden.
Diese geschlechtsspezifischen Unterschiede bei den Begleiterkrankungen zeigen, wie wichtig eine umfassende und individuelle Betreuung von RA-Patientinnen und -Patienten ist. Nur so können alle relevanten Risikofaktoren erkannt und gezielt behandelt werden, um das Risiko für Komplikationen zu verringern und die Lebensqualität zu verbessern.
Autoantikörper und serologische Unterschiede: Was die Blutwerte über das Geschlecht verraten
Bei der rheumatoiden Arthritis können bei vielen Patientinnen und Patienten bereits zu Beginn der Erkrankung bestimmte Autoantikörper im Blut nachgewiesen werden. Dazu gehören Rheumafaktoren (RF) und Antikörper gegen citrullinierte Peptide (ACPA, z.B. anti-CCP). Wenn diese Antikörper nachweisbar sind, spricht man von einer seropositiven RA. Die Seropositivität für RF und/oder ACPA ist mit einem erhöhten Risiko für Erosivität verbunden, das heißt, diese Patientinnen und Patienten haben häufiger einen gelenkzerstörenden Verlauf der Erkrankung. Zudem ist bei ACPA-positiven RA-Patienten das Risiko für eine interstitielle Lungenerkrankung (RA-ILD, eine spezielle Form der Lungenbeteiligung bei RA) erhöht. Für die Entwicklung einer RA-ILD gilt das männliche Geschlecht als zusätzlicher Risikofaktor.
Eine schwedische Studie untersuchte die Blutproben von 1600 Patientinnen und Patienten (70 % Frauen), die innerhalb eines Jahres eine RA entwickelt hatten, auf das Vorhandensein von Anti-CCP2-Antikörpern sowie verschiedenen Rheumafaktor-Subtypen (IgA, IgG und IgM). 64 % der Teilnehmenden waren anti-CCP2-positiv, 43 % positiv für RF-IgA, 33 % für RF-IgG und 57 % für IgM-RF. Frauen waren häufiger RF-IgM-positiv, während Männer häufiger RF-IgG- und IgA-positiv waren. Für die CCP2-Antikörper gab es keine Geschlechtsunterschiede, jedoch traten sie bei jüngeren RA-Patientinnen und -Patienten häufiger auf. Diese Ergebnisse zeigen, dass ACPA in der frühen RA unabhängig vom Geschlecht erhöht sind, während sich die Verteilung der Rheumafaktor-Subklassen unterscheidet: IgM eher bei Frauen, IgA und IgG eher bei Männern. Diese Unterschiede sollten bei der Beurteilung der Antikörper-Serologie, insbesondere in der Frühphase der RA, berücksichtigt werden.
Die Kenntnis dieser serologischen Unterschiede kann helfen, das individuelle Risiko für bestimmte Komplikationen besser einzuschätzen und die Therapie entsprechend anzupassen.
Inanspruchnahme des Gesundheitssystems: Wer sucht wann Hilfe?
Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Versorgung von RA-Patientinnen und -Patienten ist die Nutzung des Gesundheitssystems. In einer aktuellen kanadischen Kohortenstudie wurde untersucht, wie sich das Geschlecht auf die Häufigkeit von Arztbesuchen, Labor- und bildgebenden Untersuchungen auswirkt. Die Studie schloss Patientinnen und Patienten mit RA, Psoriasis-Arthritis und ankylosierender Spondylitis ein und analysierte deren Gesundheitsverhalten drei Jahre vor und drei Jahre nach Diagnosestellung.
Das Ergebnis: Frauen suchten sowohl vor als auch nach der Diagnosestellung häufiger rheumatologische Fachärzte auf als Männer. Sie erhielten auch öfter Labor- und bildgebende Untersuchungen. Dies deutet auf ein besseres Gesundheitsbewusstsein bei Frauen hin. Dennoch bleibt die Frage, warum die Diagnose einer entzündlichen Arthritis bei Frauen nicht früher gestellt wird, obwohl sie häufiger medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Eine frühzeitige Diagnose ist entscheidend, um das Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern und die Lebensqualität zu erhalten.
Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, geschlechtsspezifische Strategien sowohl für die Frühdiagnose als auch für die Behandlung von entzündlichen Arthritiden zu entwickeln. Ziel ist es, die Unterschiede im Krankheitsverlauf zwischen männlichen und weiblichen Patienten zu verringern und allen Betroffenen eine optimale Versorgung zu ermöglichen.
Fazit: Was bedeutet das für Patientinnen und Patienten mit RA?
Die Erkenntnisse der Gendermedizin zeigen, dass Frauen und Männer mit rheumatoider Arthritis sich in vielen Bereichen unterscheiden: von der Häufigkeit der Erkrankung, über das Alter bei Diagnosestellung, den Krankheitsverlauf, das Schmerz- und Fatigue-Erleben, bis hin zu Begleiterkrankungen und der Nutzung des Gesundheitssystems. Diese Unterschiede beeinflussen das Outcome der Erkrankung und sollten bei der Behandlung unbedingt berücksichtigt werden.
Das Wissen um geschlechtsspezifische Einflussfaktoren hilft Ärztinnen und Ärzten, das Ansprechen auf verschiedene Therapieoptionen besser einzuschätzen und die individuelle Versorgung von Frauen und Männern mit RA zu optimieren. Für Patientinnen und Patienten bedeutet dies, dass sie von einer personalisierten Medizin profitieren können, die ihre individuellen Bedürfnisse und Risiken berücksichtigt. Sprechen Sie mit Ihrem behandelnden Arzt oder Ihrer Ärztin über geschlechtsspezifische Aspekte Ihrer Erkrankung und lassen Sie sich zu den für Sie passenden Therapieoptionen beraten.
- Frauen und Männer mit RA unterscheiden sich in vielen Aspekten, die für die Behandlung und Prognose wichtig sind.
- Von der Manifestation über den Verlauf bis zum Erleben der Erkrankung gibt es zahlreiche geschlechtsspezifische Besonderheiten.
- Das Wissen um diese Unterschiede ermöglicht eine individuellere und bessere Versorgung für alle Betroffenen.
PD Dr. med. Sarah Ohrndorf
Quellen
- Klein SL, Flanagan KL: Sex differences in immune responses. Nat Rev Immunol 2016; 16(10): 626–638; doi: 10.1038/nri.2016.90.
- Smolen JS, Landewé RBM, Bergstra SA, et al.: EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2022 update. Ann Rheum Dis 2023; 82(1): 3–18; doi: 10.1136/ard-2022-223356.
- Tengstrand B, Ahlmén M, Hafström I: The influence of sex on rheumatoid arthritis: a prospective study of onset and outcome after 2 years. J Rheumatol 2004; 31(2): 214–222.
- Schrepf A, Kaplan CM, Ichesco E, et al.: A multi-modal MRI study of the central response to inflammation in rheumatoid arthritis. Nat Commun 2018; 9(1): 2243.
- Aloisi AM, Affaitati G, Ceccarelli I, et al.: Estradiol and testosterone differently affect visceral pain-related behavioural responses in male and female rats. Eur J Pain 2010; 14(6): 602–607.
- Niesters M, Dahan A, Kest B, et al.: Do sex differences exist in opioid analgesia? A systematic review and meta-analysis of human experimental and clinical studies. Pain 2010; 151(1): 61–68.
- Mogil JS: Qualitative sex differences in pain processing: emerging evidence of a biased literature. Nat Rev Neurosci 2020; 21: 353–365.
- Gazerani P, Aloisi AM, Ueda H: Editorial: Differences in Pain Biology, Perception, and Coping Strategies: Towards Sex and Gender Specific Treatments. Front Neurosci 2021; 15: 697285.
- Keogh E: The gender context of pain. Health Psychol Rev 2021; 15(3): 454–481.
- Davis MC, Okun MA, Kruszewski D, et al.: Sex differences in the relations of positive and negative daily events and fatigue in adults with rheumatoid arthritis. J Pain 2010; 11(12): 1338–1347.
- Thiele K, Albrecht K, Alexander T, et al.: Kerndokumentation der regionalen kooperativen Rheumazentren – Versorgungstrends 2024; doi: 10.17169/refubium-41983.
- Luque Ramos A, Redeker I, Hoffmann F, et al.: Comorbidities in Patients with Rheumatoid Arthritis and Their Association with Patient-reported Outcomes: Results of Claims Data Linked to Questionnaire Survey. J Rheumatol 2019; 46(6): 564–571; doi: 10.3899/jrheum.180668.
- Albrecht K: Gender-spezifische Unterschiede der Komorbidität bei rheumatoider Arthritis [Gender-specific differences in comorbidities of rheumatoid arthritis]. Z Rheumatol 2014; 73(7): 607-614.
- Arnason JA, Jónsson T, Brekkan A, et al.: Relation between bone erosions and rheumatoid factor isotypes. Ann Rheum Dis 1987; 46(5): 380–384.
- Fazeli MS, Khaychuk V, Wittstock K, et al.: Rheumatoid arthritis-associated interstitial lung disease: epidemiology, risk/prognostic factors, and treatment landscape. Clin Exp Rheumatol 2021; 39(5): 1108-–1118.
- Pertsinidou E, Manivel VA, Westerlind H, et al.: Rheumatoid arthritis autoantibodies and their association with age and sex. Clin Exp Rheumatol 2021; 39(4): 879–882.
- Tarannum S, Widdifield J, Wu CF, et al.: Understanding sex-related differences in healthcare utilisation among patients with inflammatory arthritis: a population-based study. Ann Rheum Dis 2023; 82(2): 283–291.


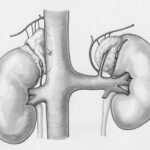

Comments are closed.