Das akute Koronarsyndrom (ACS) ist eine ernste Herzerkrankung, bei der eine schnelle und gezielte Behandlung entscheidend ist. In diesem Artikel, der auf den Empfehlungen der European Society of Cardiology (ESC) basiert, erfahren Sie, wie die Akutversorgung und die Sekundärprävention bei ACS, insbesondere bei STEMI (ST-Hebungsinfarkt) und NSTEMI (Nicht-ST-Hebungsinfarkt), ablaufen. Sie erhalten einen verständlichen Überblick über die aktuellen Leitlinien, wichtige Therapieoptionen und was Sie als Patient wissen sollten.
Was ist das akute Koronarsyndrom (ACS)?
Das akute Koronarsyndrom (ACS) bezeichnet eine Gruppe von plötzlich auftretenden, lebensbedrohlichen Herzkrankheiten, die durch eine verminderte Durchblutung des Herzmuskels (Myokard) verursacht werden. Zu den Hauptformen gehören der ST-Hebungsinfarkt (STEMI) und der Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI). Ein STEMI ist durch typische Veränderungen im EKG (Elektrokardiogramm) mit ST-Streckenhebung gekennzeichnet, während beim NSTEMI diese Veränderungen fehlen, aber dennoch eine Schädigung des Herzmuskels vorliegt. Beide Formen können sich durch starke Brustschmerzen (Angina pectoris), die oft mit vegetativen Symptomen wie Schwitzen, Übelkeit oder Atemnot einhergehen, äußern. Die schnelle Diagnose und Behandlung ist entscheidend, um bleibende Schäden am Herzen zu verhindern.
Die ESC-Leitlinien empfehlen, bei Verdacht auf ein ACS möglichst innerhalb von 10 Minuten nach dem ersten Arztkontakt ein 12-Kanal-EKG durchzuführen. Das EKG ist ein wichtiges Instrument, um zwischen STEMI und NSTEMI zu unterscheiden. Zusätzlich wird die Bestimmung des hochsensitiven (hs) Troponin-Wertes im Blut empfohlen. Troponin ist ein Eiweiß, das bei einer Schädigung des Herzmuskels freigesetzt wird. Ein dynamischer Anstieg des hs-Troponins, gemessen im sogenannten 0/1h-Algorithmus (Messung bei Aufnahme und nach einer Stunde), hilft, einen Herzinfarkt sicher zu erkennen. Je höher der Troponinwert bei Aufnahme oder je stärker der Anstieg, desto wahrscheinlicher liegt ein Myokardinfarkt vor.
Bei Patienten mit Herzstillstand oder Kreislaufproblemen (hämodynamischer Instabilität) sollte nach dem EKG eine Echokardiografie (Ultraschalluntersuchung des Herzens) erfolgen. Falls der Verdacht auf eine Aortendissektion (Einriss der Hauptschlagader) oder eine Lungenembolie (Blutgerinnsel in der Lunge) besteht, werden zusätzlich D-Dimere (Blutwerte, die auf eine Gerinnselbildung hinweisen) und eine CT-Angiografie (CCTA, bildgebendes Verfahren zur Darstellung der Herzkranzgefäße) empfohlen.
Wichtige Abkürzungen, die im Zusammenhang mit ACS häufig verwendet werden, sind: CCTA (Coronary computed tomography angiography), CMR (Cardiac magnetic resonance), DOAK (direkt wirkende orale Antikoagulanzien), NOAK (neuartige orale Antikoagulanzien), PCI (perkutane Koronarintervention, also das “Aufdehnen” verschlossener Herzkranzgefäße mittels Katheter), HBR (hohes Blutungsrisiko) und MVD (Mehrgefäßerkrankung, also das gleichzeitige Vorliegen von Verengungen in mehreren Herzkranzgefäßen).
Akutversorgung: Invasives Management und Reperfusion
Die Akutversorgung bei STEMI und NSTEMI unterscheidet sich in einigen Punkten, wobei die schnelle Wiederherstellung der Durchblutung (Reperfusion) im Vordergrund steht. Beim STEMI ist es wichtig, dass die betroffenen Patienten innerhalb von 60 Minuten nach Diagnosestellung in der Notaufnahme eine Koronar-Revaskularisation (Wiedereröffnung des verschlossenen Herzkranzgefäßes) erhalten. Dies geschieht meist durch eine perkutane Koronarintervention (PCI), bei der ein Katheter über die Leiste oder das Handgelenk eingeführt wird, um das betroffene Gefäß zu erweitern und einen Stent einzusetzen.
Falls es nicht möglich ist, innerhalb von 120 Minuten eine PCI durchzuführen, sollte spätestens innerhalb von 12 Stunden nach Symptombeginn eine fibrinolytische Therapie (medikamentöses Auflösen des Blutgerinnsels) erfolgen. Beim NSTEMI ist das Vorgehen etwas anders: Hier wird das Risiko des Patienten individuell eingeschätzt. Liegt ein sehr hohes Risiko vor (z. B. instabile Kreislaufsituation, wiederholte Brustschmerzen, lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen), sollte möglichst innerhalb von 24 Stunden eine invasive Behandlung erfolgen. Diese sogenannte “early invasive strategy” wurde in den Leitlinien von Klasse IA auf Klasse IIA herabgestuft, da Studien keinen klaren Vorteil hinsichtlich der Sterblichkeit zeigen konnten. Dennoch zeigte sich, dass eine frühzeitige Behandlung das Risiko für erneute Ischämien (Durchblutungsstörungen) und längere Krankenhausaufenthalte senkt.
Die Entscheidung, ob eine sofortige oder verzögerte invasive Therapie notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Schwere der Symptome, das Vorliegen von Begleiterkrankungen und die Ergebnisse der ersten Untersuchungen. Bei unklaren Fällen kann eine weitere Bildgebung, wie die CMR (Kardio-MRT), helfen, die richtige Therapie zu bestimmen.
Mehrgefäßerkrankung (MVD) und individuelle Therapieansätze
Viele Patienten mit ACS leiden an einer Mehrgefäßerkrankung (MVD), das heißt, es sind mehrere Herzkranzgefäße betroffen. In solchen Fällen ist die Wahl der Revaskularisierungsstrategie besonders wichtig. Es kann entweder nur das infarktverursachende Gefäß behandelt werden (Infarkt-bezogene Arterien-PCI) oder eine komplette Revaskularisation aller betroffenen Gefäße erfolgen, entweder mittels PCI oder einer koronaren Bypass-Operation.
Studien zeigen, dass bei STEMI-Patienten mit MVD eine vollständige Revaskularisation das Überleben verbessert. Die COMPLETE-Studie und weitere Metaanalysen belegen, dass eine präventive Komplettsanierung der Koronarien die Rate an Reinfarkten (erneuten Herzinfarkten) und Herz-Kreislauf-Todesfällen signifikant senken kann. Beispielsweise lag die Reinfarktrate bei vollständiger Revaskularisation bei 7,8 % gegenüber 10,5 % in der Gruppe, in der nur das Hauptproblem behandelt wurde. Die Sterblichkeit durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen konnte von 16,7 % auf 8,9 % gesenkt werden.
Für NSTEMI-Patienten gibt es bisher nur wenige Daten zur kompletten Revaskularisation. Um diese Wissenslücke zu schließen, wurde die groß angelegte, randomisierte COMPLETE-NSTEMI-Studie ins Leben gerufen. Hier wird untersucht, ob auch bei NSTEMI-Patienten eine vollständige Behandlung aller betroffenen Gefäße Vorteile bringt. Die Ergebnisse werden in den kommenden Jahren erwartet und könnten die Empfehlungen weiter verändern.
Die Wahl der Therapie hängt immer vom individuellen Zustand des Patienten, den Begleiterkrankungen und dem Ausmaß der Gefäßveränderungen ab. Ihr behandelnder Kardiologe wird diese Faktoren sorgfältig abwägen und mit Ihnen besprechen, welche Strategie für Sie am besten geeignet ist.
Monitoring und Sekundärprävention nach der Akutbehandlung
Nach einer erfolgreichen Reperfusion, also der Wiederherstellung der Durchblutung, ist eine sorgfältige Überwachung (Monitoring) besonders wichtig. Standard ist heute der radiale Zugang (über das Handgelenk) für die PCI und der Einsatz von medikamentenbeschichteten Stents, die das Risiko eines erneuten Gefäßverschlusses senken. Intravaskuläre Bildgebung (z. B. Ultraschall im Gefäß) kann in bestimmten Fällen zur besseren Steuerung der PCI eingesetzt werden, vor allem bei unklaren Gefäßveränderungen.
Eine routinemäßige Thrombusaspiration (Absaugen von Blutgerinnseln) wird laut Leitlinie nicht mehr empfohlen, da sie keinen zusätzlichen Nutzen bringt. Falls eine PCI nicht möglich oder erfolglos ist und ein großer Bereich des Herzmuskels gefährdet ist, kann eine koronare Bypass-Operation in Betracht gezogen werden.
Patienten mit hohem Risiko, insbesondere alle STEMI-Patienten, sollten nach der Behandlung auf einer Intensivstation überwacht werden. Hier erfolgt eine kontinuierliche EKG-Überwachung, um Herzrhythmusstörungen und ST-Streckenveränderungen frühzeitig zu erkennen. Diese Überwachung sollte mindestens 24 Stunden nach Symptombeginn andauern. Vor der Entlassung aus dem Krankenhaus wird bei allen Patienten die linksventrikuläre Ejektionsfraktion (LVEF, Maß für die Pumpleistung des Herzens) bestimmt, um das Risiko für Herzschwäche einzuschätzen.
Die Sekundärprävention, also die Vorbeugung eines erneuten Ereignisses, beginnt so früh wie möglich nach dem ersten Herzereignis. Sie umfasst die Teilnahme an einer kardialen Rehabilitation (strukturiertes Trainings- und Schulungsprogramm), die Anpassung des Lebensstils (z. B. Rauchstopp, gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung) und eine gezielte medikamentöse Behandlung. Studien zeigen, dass diese Maßnahmen die Lebensqualität verbessern und sowohl die Krankheitshäufigkeit (Morbidität) als auch die Sterblichkeit senken.
Antithrombotische Therapie und spezielle Patientengruppen
Ein zentraler Bestandteil der Behandlung des ACS ist die antithrombotische Therapie, also die Hemmung der Blutgerinnung, um erneute Gefäßverschlüsse zu verhindern. Alle Patienten erhalten eine Kombination aus Plättchenhemmern (z. B. Aspirin) und Antikoagulanzien (Gerinnungshemmern). Zusätzlich zu Aspirin wird für 12 Monate ein P2Y12-Antagonist empfohlen, sofern das individuelle Blutungsrisiko (HBR) dies zulässt. Prasugrel und Ticagrelor werden dabei gegenüber Clopidogrel bevorzugt, insbesondere bei Patienten, die eine PCI erhalten. Für Patienten, die sich einer PCI unterziehen, ist Prasugrel die erste Wahl.
Eine Vorbehandlung mit einem P2Y12-Antagonisten vor der Koronarangiografie kann bei STEMI-Patienten, die eine primäre PCI erhalten, erwogen werden. Bei NSTEMI-Patienten wird dies jedoch meist nicht empfohlen. Parenterale Antikoagulation (Verabreichung von Gerinnungshemmern über die Vene) sollte bei allen Patienten zum Zeitpunkt der Diagnose erfolgen und kann nach dem Eingriff wieder abgesetzt werden.
Bei bestimmten Patienten, insbesondere bei Vorhofflimmern (Herzrhythmusstörung mit erhöhtem Schlaganfallrisiko), ist eine langfristige Antikoagulation notwendig. Hier wird zunächst eine Dreifachtherapie (DOAK, Aspirin und P2Y12-Antagonist) empfohlen, gefolgt von einer Zweifachtherapie mit einem NOAK und einem einzelnen oralen Plättchenhemmer (vorzugsweise Clopidogrel) zur Schlaganfallprävention.
Auch spezielle Patientengruppen wie Menschen mit chronischer Nierenerkrankung (CKD, chronische Einschränkung der Nierenfunktion) oder Krebserkrankungen erfordern eine individuell angepasste Therapie. Über 30 % der ACS-Patienten haben eine moderate oder schwere CKD, was Auswirkungen auf die Auswahl und Dosierung der Medikamente hat. Bei Krebspatienten müssen mögliche Wechselwirkungen und Nebenwirkungen besonders beachtet werden.
Weitere wichtige Aspekte aus den ESC-Leitlinien
Die ESC-Leitlinien enthalten zahlreiche weitere Empfehlungen, die für bestimmte Patientengruppen oder spezielle Situationen relevant sind. Ein Beispiel ist die spontane Koronardissektion (plötzlicher Einriss einer Herzkranzarterie), eine seltene Ursache des ACS mit einer Prävalenz von 0,1–4 %. Besonders junge Frauen sind mit einer Prävalenz von 8,7 % häufiger betroffen. Nicht jede Koronardissektion muss mit einem Stent behandelt werden. Eine PCI wird nur empfohlen, wenn Anzeichen einer anhaltenden Myokardischämie (anhaltende Durchblutungsstörung des Herzmuskels), ein großes gefährdetes Myokardareal oder ein reduzierter antegrader Fluss (verminderte Durchblutung nach vorne) vorliegen.
Bei instabilem ACS, also einer besonders bedrohlichen Form, wird bei reanimierten Patienten nach Herzstillstand und einem EKG mit persistierender ST-Hebung eine primäre PCI empfohlen. Liegt keine ST-Hebung vor, sollte zunächst keine sofortige Angiografie erfolgen. Wichtig ist auch die kontinuierliche Überwachung der Körperkerntemperatur und die aktive Vorbeugung von Fieber (über 37,7°C) bei Patienten mit Herzstillstand außerhalb des Krankenhauses.
Ein weiteres wichtiges Thema ist MINOCA (Myokardinfarkt ohne obstruktive Atherosklerose), also ein Herzinfarkt, bei dem keine relevanten Verengungen der Herzkranzgefäße nachweisbar sind. MINOCA ist eine Arbeitsdiagnose, die verschiedene Ursachen haben kann, sowohl im Herzen selbst als auch außerhalb. Sie betrifft etwa 1–14 % der ACS-Patienten. Die kardiovaskuläre Magnetresonanztomografie (CMR) ist hier ein wichtiges diagnostisches Verfahren, um die Ursache zu klären. Häufige Auslöser sind Plaquerupturen (Aufbrechen von Ablagerungen in den Gefäßen) oder Koronarspasmen (krampfartige Verengungen der Herzkranzgefäße).
Die ESC-Leitlinien empfehlen außerdem, bei Komplikationen wie einer KHK (koronaren Herzkrankheit) nach ACS eine Notfall-Koronarangiografie durchzuführen. Der routinemäßige Einsatz einer intraaortalen Ballongegenpulsation (mechanische Unterstützung der Herzfunktion) wird bei ACS-Patienten ohne mechanische Komplikationen nicht empfohlen.
Für einen kompakten Überblick aller wichtigen Punkte und Anpassungen der ESC-Leitlinie steht ein 16-seitiges Dokument zur Verfügung, das die “Essential Messages” zusammenfasst. Ihr behandelnder Arzt kann Ihnen bei Fragen zu den individuellen Empfehlungen und deren Bedeutung für Ihre persönliche Situation weiterhelfen.
Mirjam Peter, M.Sc.
Quellen
- «KHK: Akutes Koronarsyndrom und Revaskularisation», Prof. Dr. med. Tanja Rudolph, DGK Cario Update, 23.–24.02.2024, Mainz.
- «Empfehlungen für die Akutversorgung», Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK), 2022, https://leitlinien.dgk.org, (letzter Abruf 06.05.2024)
- «Essential Messages from ESC Guidelines Clinical Practice Guidelines Committee», www.escardio.org, (letzter Abruf 06.05.2024)
- «Comments on the 2023 ESC guidelines for the management of acute coronary syndromes/ Comentarios a la guia ESC 2023 sobre el diagnostico und tratamiento de los sindromes coronarios agudos», Editorial, Revista Española de Cardiología (English Edition) 2024; 77(Issue 3): 201–205.
- Wald DS et al.: Randomized Trial of Preventive Angioplasty in Myocardial Infarction. N Engl J Med 2013; 369: 1115–1123 September 19, 2013. doi: 10.1056/NEJMoa1305520
- Bainey KR et al.: Complete vs culprit-only revascularization for patients with multivessel disease undergoing primary percutaneous coronary intervention for ST-segment elevation myocardial infarction: A systematic review and meta-analysis. American Heart Journal 2014; 167 (1): 1–14.e2.
- Bainey KR, et al.: Complete vs Culprit-Lesion-Only Revascularization for ST-Segment Elevation Myocardial Infarction A Systematic Review and Meta-analysis JAMA Cardiol. Published online May 20, 2020. doi:10.1001/jamacardio.2020.1251
- Oqab Z, et al.: Complete Revascularization Versus Culprit-Lesion-Only PCI in STEMI Patients With Diabetes and Multivessel Coronary Artery Disease: Results From the COMPLETE Trial. Circ Cardiovasc Interv 2023 Sep; 16(9): e012867.
- «Complete Revascularization Versus Culprit Lesion Only PCI in NSTEMI (CompleteNSTEMI)», https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05786131.
- Saw J: Spontaneous coronary artery dissection. Can J Cardiol 2013; 29(9): 1027–1033.
- «Koexistenz von kalzifizierten und lipidhaltigen Plaque-Komponenten und deren Zusammenhang mit inzidentellen Rupturpunkten bei akuten Koronarsyndrom (ACS) verursachenden Culprit-Läsionen – Ergebnisse der prospektiven OPTICO-ACS-Studie», https://refubium.fu-berlin.de, (letzter Abruf 06.05.2024)
- Byrne RA, et al; ESC Scientific Document Group. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J 2023; 44(38): 3720–3826.

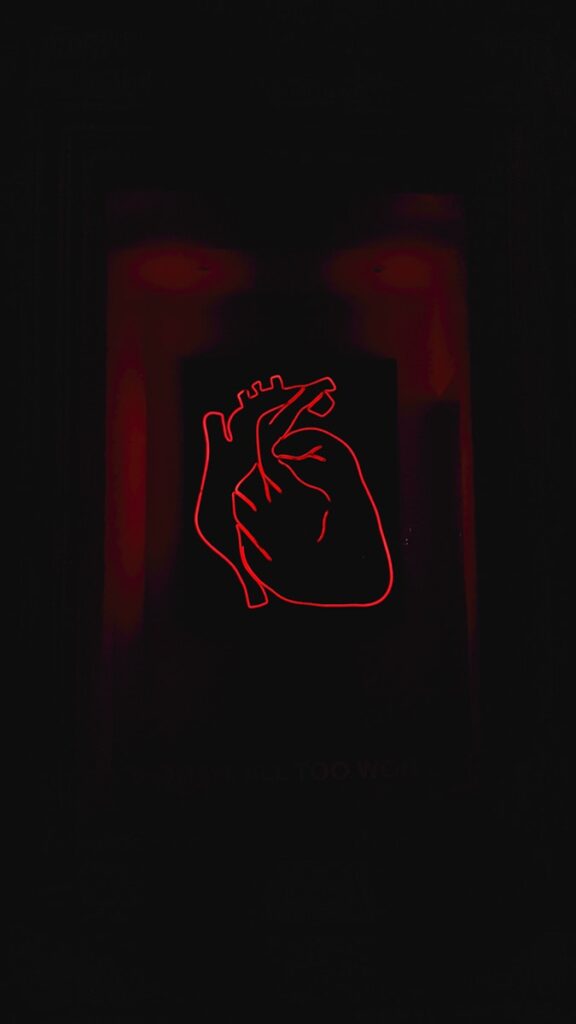


Comments are closed.