Patienten mit Niereninsuffizienz und Vorhofflimmern haben ein besonders hohes Risiko für einen ischämischen Schlaganfall. Die Wahl der richtigen Antikoagulation ist dabei entscheidend, um das Risiko für Schlaganfälle und Blutungskomplikationen zu minimieren. Dieser Artikel basiert auf CARDIOVASC und erklärt Ihnen verständlich, welche Therapieoptionen es gibt, worauf Sie achten sollten und wie die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse die Behandlung beeinflussen.
Was ist Niereninsuffizienz und wie wird sie eingeteilt?
Die chronische Niereninsuffizienz (CNI) ist eine dauerhafte und nicht umkehrbare Einschränkung der Nierenfunktion. Das bedeutet, dass die Nieren nicht mehr in der Lage sind, Abbauprodukte wie Kreatinin, Harnstoff und Harnsäure (Stoffwechselprodukte des Eiweißstoffwechsels) ausreichend aus dem Blut zu filtern. Dadurch kommt es zu einer Anreicherung dieser Substanzen im Blut, was zu einer Störung des Wasser- und Elektrolythaushalts führen kann. Bereits ab dem 30. Lebensjahr ist die CNI mit einer Prävalenz von 7,2 % relativ häufig, und im höheren Alter steigt diese Zahl deutlich an – bei Menschen über 70 Jahren liegt sie bei etwa 37,8 %. Die CNI wird anhand der glomerulären Filtrationsrate (GFR, ein Maß für die Filterleistung der Niere) sowie dem Nachweis von Albuminurie (Eiweiß im Urin) und Proteinurie (weitere Eiweiße im Urin) definiert.
Zur Bestimmung der GFR gibt es verschiedene Methoden. Die genaueste Methode ist die Messung im 24-Stunden-Urin, allerdings ist dies im Alltag oft nicht praktikabel. Daher wird meist die geschätzte GFR (eGFR) verwendet, die mithilfe von Formeln wie Cockroft-Gault, MDRD-Studie oder CKD-EPI berechnet wird. Je nach Berechnungsmethode kann die eGFR vor allem in fortgeschrittenen Stadien der Niereninsuffizienz unterschiedlich ausfallen. Die Einteilung der CNI erfolgt in fünf Stadien, abhängig von der GFR und dem Ausmaß der Proteinurie. Diese Einteilung hilft Ärzten, das Risiko für Komplikationen besser einzuschätzen und die Therapie individuell anzupassen.
Die Stadien der CNI reichen von Stadium I (leichte Einschränkung der Nierenfunktion) bis Stadium V (schwerste Einschränkung, oft Dialysepflicht). Besonders ab Stadium III steigt das Risiko für Komplikationen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfälle deutlich an. Daher ist eine regelmäßige Kontrolle der Nierenfunktion für Patienten mit CNI sehr wichtig, um rechtzeitig auf Veränderungen reagieren zu können.
Vorhofflimmern: Was bedeutet das für die Herzgesundheit?
Vorhofflimmern (VHF) ist eine häufige Herzrhythmusstörung, bei der die Vorhöfe des Herzens unkoordiniert schlagen. Es handelt sich um eine intermittierende (zeitweise auftretende) oder permanente (dauerhafte) Störung, die nicht von der Mitralklappe ausgeht (daher nicht-valvulär genannt). Die Einteilung des Schweregrads erfolgt nach der NYHA-Klassifikation, die ursprünglich für die Herzinsuffizienz entwickelt wurde, und berücksichtigt die Symptome und die Einschränkung der Lebensqualität durch das VHF.
Die Prävalenz von VHF liegt bei etwa 1 % der Gesamtbevölkerung. In der Altersgruppe zwischen 50 und 59 Jahren sind etwa 0,5 % betroffen, während bei Menschen über 85 Jahren bis zu 18 % an VHF leiden. Das Risiko für Komplikationen wie Schlaganfälle steigt mit dem Alter und mit dem Vorliegen weiterer Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Niereninsuffizienz deutlich an.
VHF kann zu einer verminderten Pumpleistung des Herzens führen, was wiederum die Durchblutung des Körpers beeinträchtigt. Besonders gefährlich ist jedoch die erhöhte Neigung zur Bildung von Blutgerinnseln (Thromben) im Herzen, die in den Blutkreislauf gelangen und dort Gefäße verschließen können. Dies ist die Hauptursache für ischämische Schlaganfälle bei Patienten mit VHF.
Zusammenhang zwischen Niereninsuffizienz und Vorhofflimmern
Mehrere wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Vorhofflimmern haben. Die Niereninsuffizienz gilt neben der arteriellen Hypertonie (Bluthochdruck) als unabhängiger Risikofaktor für VHF. Beide Erkrankungen – CNI und VHF – sind für sich genommen bereits mit einer erhöhten Sterblichkeit verbunden. Besonders kritisch ist jedoch die Kombination beider Erkrankungen, da sie das Risiko für schwere Komplikationen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Tod weiter erhöht.
In einer Studie mit 387 Patienten mit VHF wurde festgestellt, dass sowohl die eGFR als auch der CHADS2-Score (ein Bewertungssystem zur Abschätzung des Schlaganfallrisikos bei VHF) unabhängige Prädiktoren für das Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen und die Sterblichkeit sind. Das bedeutet, dass sowohl die Nierenfunktion als auch das individuelle Schlaganfallrisiko bei der Therapieentscheidung berücksichtigt werden müssen. Mit zunehmendem Alter steigt die Prävalenz von VHF und CNI weiter an, was die Bedeutung einer frühzeitigen Diagnose und Behandlung unterstreicht.
Die Wechselwirkungen zwischen Niereninsuffizienz und Vorhofflimmern sind komplex. Einerseits kann eine eingeschränkte Nierenfunktion die Entstehung von VHF begünstigen, andererseits kann VHF die Nierenfunktion weiter verschlechtern. Dies führt zu einem Teufelskreis, in dem sich beide Erkrankungen gegenseitig negativ beeinflussen. Daher ist bei Patienten mit beiden Erkrankungen eine besonders sorgfältige Überwachung und Therapie notwendig.
Risiko für Schlaganfall und Embolien bei Niereninsuffizienz und Vorhofflimmern
Vorhofflimmern ist die häufigste Ursache für ischämische Schlaganfälle (durch eine Durchblutungsstörung des Gehirns verursacht). Etwa 20–25 % aller Schlaganfälle sind auf kardioembolische Ereignisse durch VHF zurückzuführen. Nach einer transitorischen ischämischen Attacke (TIA, eine kurzfristige Durchblutungsstörung des Gehirns) oder einem Schlaganfall wird bei fast einem Viertel der Patienten ein bislang unerkanntes VHF festgestellt.
Die durch VHF verursachten Schlaganfälle sind oft größer und schwerwiegender als solche, die durch andere Ursachen wie Mikroangiopathie (Schädigung kleiner Blutgefäße) oder Makroangiopathie (Schädigung großer Blutgefäße) entstehen. Sie gehen mit schwereren neurologischen Ausfällen und einer erhöhten Sterblichkeit von 20–25 % in den ersten 30 Tagen nach dem Ereignis einher. Das Risiko für einen solchen Schlaganfall steigt bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion weiter an. Bei einer verminderten eGFR steigt das Risiko für kardioembolische Schlaganfälle auf bis zu 39 %.
Studien zeigen, dass die CNI nicht nur ein Risikofaktor für die Entstehung von VHF ist, sondern auch umgekehrt: Patienten mit VHF entwickeln häufiger eine dialysepflichtige Niereninsuffizienz. In einer dänischen Kohortenstudie mit Patienten mit nicht-valvulärem VHF und dialysepflichtiger CNI zeigte sich, dass diese Patienten ein 5,5-fach erhöhtes Risiko für ischämische Schlaganfälle und thromboembolische Ereignisse haben. Daher ist die Prävention von Schlaganfällen bei dieser Patientengruppe besonders wichtig.
Therapieoptionen: Vitamin K-Antagonisten und DOAK
Vitamin K-Antagonisten sind Medikamente, die die Bildung von Vitamin K-abhängigen Gerinnungsfaktoren (Faktoren II, VII, IX und X) hemmen. Zu den bekanntesten Vertretern zählen Warfarin, Phenprocoumon und Acenocoumarol. Die Dosierung dieser Medikamente wird individuell an die aktuelle Blutgerinnung (gemessen als INR – International Normalized Ratio) angepasst. Die Wirkung setzt meist erst nach einigen Tagen ein und hält bis zu fünf Tage an. Bei Patienten mit VHF und einem CHA2DS2-VASc-Score ≥1 gelten Vitamin K-Antagonisten als wirksamste Therapie zur Vorbeugung von ischämischen Schlaganfällen.
Bei Patienten mit Niereninsuffizienz ist die Situation jedoch komplexer. Obwohl Vitamin K-Antagonisten über viele Jahre auch bei CNI eingesetzt wurden, sind sie laut Zulassung für fortgeschrittene Stadien der Niereninsuffizienz kontraindiziert. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass Warfarin das Risiko für eine Nephrokalzinose (Ablagerung von Kalzium in der Niere) erhöht und so die Nierenfunktion langfristig verschlechtern kann. Dennoch zeigen einige Studien, dass Vitamin K-Antagonisten das Risiko für Schlaganfälle und systemische Embolien bei Patienten mit CNI senken können, insbesondere in den Stadien III und IV. Allerdings ist das Risiko für Blutungskomplikationen unter dieser Therapie erhöht.
Die neuen oralen Antikoagulanzien (DOAK) – dazu zählen Apixaban, Dabigatran, Edoxaban und Rivaroxaban – werden weltweit immer häufiger zur Prävention von Schlaganfällen bei VHF eingesetzt. Im Vergleich zu Vitamin K-Antagonisten bieten sie einige Vorteile: Sie wirken schneller, haben eine kürzere Halbwertszeit und weniger Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Zudem ist keine regelmäßige INR-Kontrolle erforderlich, und die Dosierung ist standardisiert. In großen Studien (ARISTOTLE, ENGAGE AF-TIMI 48, RE-LY und ROCKET AF) zeigten die DOAK eine vergleichbare Wirksamkeit wie Warfarin bei der Verhinderung von ischämischen Schlaganfällen. Besonders Dabigatran in der Dosierung von 150 mg war sogar wirksamer als Warfarin bei der Reduktion von Schlaganfällen.
Ein weiterer Vorteil der DOAK ist das geringere Risiko für intrakranielle Blutungen (Blutungen im Gehirn) im Vergleich zu Vitamin K-Antagonisten. Allerdings ist zu beachten, dass die Nierenfunktion einen großen Einfluss auf die Konzentration und Wirksamkeit der DOAK im Blut hat. Besonders Dabigatran wird zu 80 % über die Niere ausgeschieden und kann sich bei eingeschränkter Nierenfunktion im Körper anreichern. Daher muss die Dosierung bei CNI angepasst werden, um das Risiko für Nebenwirkungen zu minimieren.
Antikoagulation bei unterschiedlichen Stadien der Niereninsuffizienz
Die Wahl der richtigen Antikoagulation hängt maßgeblich vom Stadium der Niereninsuffizienz ab. Bei Patienten mit moderater Niereninsuffizienz (Stadium II und III) können sowohl Vitamin K-Antagonisten als auch DOAK eingesetzt werden. Besonders im Stadium II gelten DOAK als gute Alternative, da sie das Risiko für systemische Embolien und ischämische Schlaganfälle effektiv senken und gleichzeitig weniger Blutungskomplikationen verursachen. Im Stadium III ist für alle DOAK eine Dosisreduktion erforderlich, um das Risiko für Nebenwirkungen zu verringern. In reduzierter Dosierung bleiben die DOAK eine gute Option, da sie weiterhin wirksam sind und das Blutungsrisiko im Vergleich zu Vitamin K-Antagonisten geringer bleibt.
Für Patienten mit Niereninsuffizienz Stadium IV sind Rivaroxaban, Apixaban und Edoxaban in reduzierter Dosierung prinzipiell zugelassen. Allerdings wurden Patienten mit CNI Grad IV in den großen Studien meist ausgeschlossen, sodass belastbare Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit fehlen. Daher kann für dieses Stadium keine generelle Empfehlung für den Einsatz von DOAK ausgesprochen werden. In den USA, aber nicht in Europa, ist eine niedrig dosierte Variante von Dabigatran (2× 75 mg) für Patienten mit CNI Stadium IV zugelassen, basierend auf Simulationen zur Dosis und Wirksamkeit.
Im Stadium V der Niereninsuffizienz, insbesondere bei Patienten, die eine Hämodialyse benötigen, wird von einer Behandlung mit DOAK abgeraten, da keine ausreichenden Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit vorliegen. In einer Studie zeigte sich bei dialysepflichtigen Patienten unter Dabigatran und Rivaroxaban eine erhöhte Blutungsrate im Vergleich zu Warfarin, allerdings war die Patientenzahl gering. Auch Vitamin K-Antagonisten sind in diesem Stadium kontraindiziert und bieten keinen nachgewiesenen Nutzen. Die Entscheidung für eine Antikoagulation muss daher individuell und unter sorgfältiger Abwägung des Schlaganfall- und Blutungsrisikos getroffen werden.
Besonderheiten bei der Überwachung und Anpassung der Therapie
Ein großer Vorteil der DOAK ist, dass keine regelmäßige Kontrolle der Blutgerinnung (wie der INR-Wert bei Vitamin K-Antagonisten) erforderlich ist. Dennoch ist eine regelmäßige Überwachung der Nierenfunktion unerlässlich, da sich die Konzentration der DOAK bei eingeschränkter Nierenfunktion erhöhen kann. Bei Patienten mit normaler Nierenfunktion reicht eine jährliche Kontrolle aus. Bei CNI sollten die Kontrollen jedoch häufiger erfolgen, abhängig vom Stadium der Erkrankung, dem Alter, Begleiterkrankungen und dem verwendeten DOAK. Besonders bei Dabigatran und in geringerem Maße auch bei Edoxaban, die zu einem hohen Anteil über die Niere ausgeschieden werden, ist eine engmaschige Überwachung wichtig.
Die Anpassung der Dosierung erfolgt je nach eGFR und individuellen Risikofaktoren wie Alter über 80 Jahre oder Körpergewicht unter 60 kg. Für Dabigatran sollte die Dosis bei CNI Stadium III auf 2× 110 mg reduziert werden. Für Rivaroxaban, Edoxaban und Apixaban gelten ebenfalls reduzierte Dosierungen, wenn bestimmte Risikofaktoren vorliegen. Studien haben gezeigt, dass die Wirksamkeit der DOAK auch nach Dosisreduktion erhalten bleibt und das Risiko für Blutungen weiter gesenkt werden kann. Besonders bei gestörter Nierenfunktion zeigt sich ein Vorteil der DOAK gegenüber Vitamin K-Antagonisten hinsichtlich der Reduktion von Blutungskomplikationen.
Die Entscheidung für eine bestimmte Antikoagulation sollte immer gemeinsam mit dem behandelnden Arzt getroffen werden. Dabei werden individuelle Faktoren wie das Risiko für Schlaganfälle (CHA2DS2-VASc-Score), das Blutungsrisiko (HAS-BLED-Score), Begleiterkrankungen und die aktuelle Nierenfunktion berücksichtigt. Eine regelmäßige Überprüfung der Therapie ist wichtig, um auf Veränderungen der Nierenfunktion oder das Auftreten von Nebenwirkungen rechtzeitig reagieren zu können.
Fazit: Individuelle Therapieentscheidung bei hohem Risiko
Patienten mit Niereninsuffizienz und Vorhofflimmern gehören zu den Hochrisikopatienten für ischämische Schlaganfälle. Eine sorgfältig ausgewählte Antikoagulation ist daher essenziell, um das Risiko für Schlaganfälle und andere thromboembolische Ereignisse zu senken. In den Stadien II und III der Niereninsuffizienz sind DOAK eine gute Alternative zu Vitamin K-Antagonisten, da sie bei vergleichbarer Wirksamkeit weniger Blutungskomplikationen verursachen. Im Stadium III ist eine Dosisreduktion der DOAK erforderlich, um das Risiko für Nebenwirkungen zu minimieren.
In den Stadien IV und V der Niereninsuffizienz wird die Therapie komplexer. Obwohl einige DOAK in reduzierter Dosierung für Stadium IV zugelassen sind, fehlen belastbare Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit, sodass eine Neueinstellung auf diese Medikamente nicht empfohlen wird. Im Stadium V sind sowohl DOAK als auch Vitamin K-Antagonisten kontraindiziert, und es besteht kein nachgewiesener Nutzen. In diesen Fällen muss die Entscheidung für oder gegen eine Antikoagulation individuell unter Berücksichtigung des Schlaganfall- und Blutungsrisikos sowie der Begleiterkrankungen getroffen werden.
Für alle Patienten mit CNI und VHF gilt: Die regelmäßige Kontrolle der Nierenfunktion ist ein zentraler Bestandteil der Therapie. Nur so kann die Behandlung optimal an die individuellen Bedürfnisse angepasst und das Risiko für Komplikationen minimiert werden. Sprechen Sie mit Ihrem behandelnden Arzt über die für Sie beste Therapieoption und lassen Sie sich regelmäßig untersuchen, um Ihre Gesundheit bestmöglich zu schützen.
Prof. Dr. med. Wolf-Rüdiger Schäbitz
Quellen
- Zhang QL, Rothenbacher D: Prevalence of chronic kidney disease in population-based studies: systemic review. BMC Public Health 2008; 8: 117.
- National Kidney Foundation: K/DOQI clinical pratice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, and stratification. Am J Kidney Dis 2002; 39: S1–S266.
- Camm AJ, et al.: Guidelines for the management of atrial fibrillation: the Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2010; 31: 2369–2429.
- Horio T, et al.: Chronic kidney disease as an independent risk factor for new-onset atrial fibrillation in hypertensive patients. J Hypertens 2010 Aug; 28(8): 1738–1744.
- Go AS, et al.: Chronic kidney disease and the risks of death, cardiovascular events, and hospitalization. N Engl J Med 2004; 351: 1296–1305.
- Nakagawa K, et al.: Chronic kidney disease and CHADS(2) score independently predict cardiovascular events and mortality in patients with nonvalvular atrial fibrillation. Am J Cardiol 2011; 107: 912–916.
- Marini C, et al.: Contribution of atrial fibrillation to incidence and outcome of ischemic stroke: results from a population-based study. Stroke 2005; 36: 1115–1119.
- Kolominsky-Rabas PL, et al.: Epidemiology of ischemic stroke subtypes according to TOAST criteria: incidence, recurrence, and long-term survival in ischemic stroke subtypes: a population-based study. Stroke 2001; 32: 2735–2740.
- Sposato LA, et al.: Diagnosis of atrial fibrillation after stroke and transient ischaemic attack: a systemic review and meta-analysis. Lancet Neurol 2015; 14: 377–387.
- Riva N, Lip GY: A new era for anticoagulation in atrial fibrilation. Which anticoagulant should we choose for long-term prevention of thromboembolic complications in patients with atrial fibrilation? Pol Arch Med Wewn 2012; 122: 45–53.
- Go AS, et al., ATRIA Study Investigators: Impact of proteinuria and glomerular filtration rate on risk of thromboembolism in atrial fibrillation: the anticoagulation and risk factors in atrial fibrillation (ATRIA) study. Circulation 2009; 119: 1363–1369.
- Olesen JB, et al.: Stroke and bleeding in atrial fibrillation with chronic kidney disease. N Eng J Med 2012; 367: 625–635.
- Bansal N, et al.: Incident atrial fibrillation and risk of end-stage renal disease in adults with chronic kidney disease. Circulation 2013; 127: 569–574.
- Bonde AN, et al.: Net clinical benefit of antithrombotic therapy in patients with atrial fibrillation and chronic kidney disease: a nationwide observational cohort study. J Am Coll Cardiol 2014 Dec 16; 64(23): 2471–2482.
- Diener HC, Weimer C: Die neue S3-Leitlinie «Schlaganfallprävention» der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft. Psychopharmakotherapie 2013; 20: 58–65.
- Brodsky SV, et al.: Warfarin related nephropathy occurs in patients with and without chronic kidney disease and is associated with an increased mortality rate. Kidney Int 2011 Jul; 80(2): 181–189.
- Carrero JJ, et al.: Warfarin, Kidney Dysfunction, and Outcomes Following Acute Myocardial Infarction in Patients With Atrial Fibrillation. JAMA 2014; 311(9): 919–928.
- Shah M, et al.: Warfarin Use and the Risk for Stroke and Bleeding in Patients With Atrial Fibrillation Undergoing Dialysis. Circulation 2014; 129: 1196–1203.
- Granger CB, et al., ARISTOTLE Committees and Investigators: Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrilation. N Engl J Med 2011; 365: 981–992.
- Patel MR, et al., ROCKET AF Investigators: Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. N Engl J Med 2011; 365: 883–891.
- Connolly SJ, et al., RE-LY Steering Committee and Investigators: Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrilation. N Engl J Med 2009; 361: 1139–1151.
- Giugliano RP, et al.: Edoxaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2013; 369: 2093–2104.
- Lip GY, et al.: Indirect comparisons of new oral anticoagulant drugs for efficacy and safety when used for stole prevention in atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol 2012; 60: 738–746.
- Ruff CT, et al.: Comparison of the efficacy and safety of new oral anticoagulants with warfarin in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis of randomized trials. Lancet 2014; 383: 955–962.
- Hohnloser SH, et al.: Efficacy of apixaban when compared with warfarin in relation to renal function in patients with atrial fibrillation: insights from the ARISTOTLE trial. Eur Heart J 2012; 33: 2821–2830.
- Fox KA, et al.: Prevention of stroke and systemic embolism with rivaroxaban compared with warfarin in patients with non-valvular atrial fibrillation and moderate renal impairment. Eur Heart J 2011; 32: 2387–2394.
- Hijazi Z, et al.: Efficacy and Safety of Dabigatran Compared With Warfarin in Relation to Baseline Renal Function in Patients With Atrial Fibrillation. Circulation 2014; 129: 961–970.
- Pathak R, et al.: Meta-analysis on risk of bleeding with apixaban in patients with renal impairment. Am J Cardiol 2015 Feb 1; 115(3): 323–327.
- Heidbuchel H, et al.: Updated European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist anticoagulants in patients with non-valvular
- atrial fibrillation. Europace 2015 Oct; 17(10): 1467–1507.
- Sardar P, et al.: Novel oral anticoagulants in patients with renal insufficiency: a meta-analysis of randomized trials. Can J Cardiol 2014 Aug; 30(8): 888–897.
- Chan KE, et al.: Dabigatran and Rivaroxaban Use in Atrial Fibrillation Patients on Hemodialysis. Circulation 2015; 131: 972–979.
- Reinecke H, Engelbertz C, Schäbitz WR: Preventing stroke in patients with chronic kidney disease and atrial fibrillation: benefit and risks of old and new oral anticoagulants. Stroke 2013 Oct; 44(10): 2935–2941.

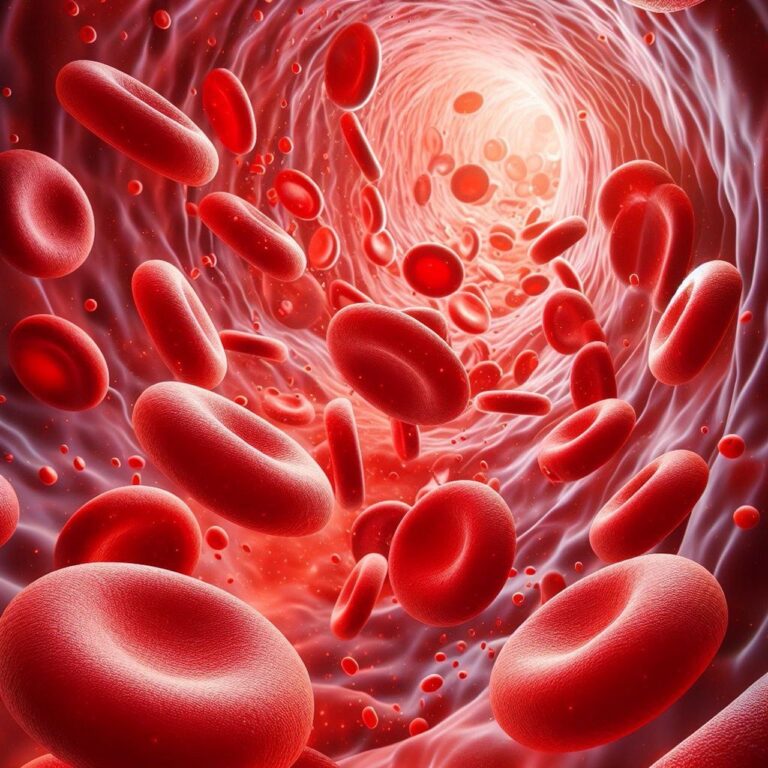

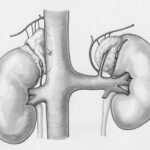
Comments are closed.