Die Behandlung der COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) entwickelt sich stetig weiter. Neue Erkenntnisse zeigen, dass nicht jeder Patient von einem inhalativen Steroid (ICS) profitiert. Dieser Artikel basiert auf FomF WebUp Pneumologie und erklärt, wie Bluteosinophile (eine spezielle Art weißer Blutkörperchen) und individuelle Merkmale die Therapie beeinflussen und warum eine Übertherapie mit ICS vermieden werden sollte.
Individuelle Therapieansätze bei COPD: Was sind „treatable traits“?
In der modernen COPD-Therapie steht der Begriff „treatable traits“ (behandelbare Merkmale) im Mittelpunkt. Damit ist gemeint, dass die Behandlung nicht mehr nur nach allgemeinen Symptomen, sondern gezielt nach bestimmten Eigenschaften des Patienten ausgerichtet wird. Neben der Schwere der Atemnot und der Häufigkeit von Exazerbationen (akuten Verschlechterungen der Symptome) werden auch Marker wie die Bluteosinophilen (eine Untergruppe der weißen Blutkörperchen, die bei Entzündungsprozessen eine Rolle spielen) berücksichtigt. Diese Herangehensweise ermöglicht es, die Therapie individuell auf den Patienten abzustimmen und unnötige Medikamente zu vermeiden.
Ein typischer Fall aus dem Alltag eines Lungenarztes verdeutlicht dies: Ein 64-jähriger Mann leidet seit mindestens drei Jahren unter Belastungsluftnot (Atemnot bei körperlicher Anstrengung). Er hustet gelegentlich, hatte aber keine Exazerbationen. Seine Vorgeschichte zeigt 42 pack years (Jahre, in denen er täglich eine Packung Zigaretten geraucht hat), inzwischen hat er das Rauchen aufgegeben. Als Nebenerkrankung ist nur eine arterielle Hypertonie (Bluthochdruck) bekannt, die medikamentös behandelt wird.
Um die Belastungsluftnot besser einzuschätzen, wurde eine Dyspnoe-Quantifizierung nach der mMRC-Skala (Modified Medical Research Council Dyspnoe-Skala, ein Fragebogen zur Bewertung der Atemnot) durchgeführt. Der Patient wurde entsprechend seiner Angaben in Grad I eingestuft, was bedeutet, dass die Luftnot nur bei schnellem Gehen oder leichter Steigung auftritt. Die Lungenfunktionsprüfung zeigte eine typische konkave Flussvolumenkurve. Nach Inhalation eines kurzwirksamen Betamimetikums (ein Medikament, das die Bronchien erweitert) verbesserte sich die Kurve nur geringfügig. Der FEV1-Wert (forciertes exspiratorisches Volumen in 1 Sekunde, ein Maß für die Lungenfunktion) nach Bronchodilatation lag bei 56 % des Sollwerts. Das spricht für eine mindestens mittelschwere obstruktive Ventilationsstörung, also eine fortgeschrittene COPD, die nicht gut auf Bronchodilatatoren anspricht.
GOLD-Klassifikation und aktuelle Empfehlungen zur Therapie
Früher wurde die COPD fast ausschließlich anhand der Spirometrie (Lungenfunktionsmessung) und der Einteilung in GOLD-Stufen (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) bewertet. Heute fließen weitere Faktoren wie die Exazerbationsrate und das Ausmaß der Atemnot in die Therapieentscheidung ein. Patienten ohne oder mit nur einer Exazerbation pro Jahr werden in die Gruppen A oder B eingeteilt, abhängig davon, wie stark die Belastungsluftnot ausgeprägt ist. Im oben beschriebenen Fall hatte der Patient keine Exazerbationen und einen mMRC-Score von 1, weshalb er in Gruppe A eingestuft wurde.
Für Patienten der Gruppe A empfehlen die Leitlinien lediglich einen Bronchodilatator, unabhängig von anderen Maßnahmen wie Rauchstopp, Selbstmanagement, körperlicher Aktivität oder pulmonaler Rehabilitation (ein spezielles Trainingsprogramm für Lungenpatienten). Es wird dabei nicht einmal festgelegt, welcher Bronchodilatator eingesetzt werden soll – die Wahl bleibt dem Arzt und den Vorlieben des Patienten überlassen. Ziel ist es, die Therapie so einfach und individuell wie möglich zu gestalten und unnötige Medikamente zu vermeiden.
Übertherapie mit inhalativen Steroiden: Ein Problem in der Praxis
In der Realität zeigt sich jedoch, dass viele Patienten bereits in der Gruppe A mit inhalativen Steroiden (ICS) behandelt werden. Diese Medikamente sind eigentlich für bestimmte Patientengruppen vorgesehen, werden aber oft auch dann eingesetzt, wenn ihr Nutzen fraglich ist. In der Schweiz ist dies besonders auffällig: Viele Patienten erhalten Kombinationstherapien wie LABA/LAMA/ICS (langwirksame Beta-Agonisten und Muskarinantagonisten plus inhalatives Steroid), LABA/ICS oder LAMA/LABA, obwohl die Leitlinien dies nicht empfehlen. Das führt zu einer Übertherapie mit ICS, die nicht nur unnötig ist, sondern auch das Risiko für Nebenwirkungen wie Infektionen der Atemwege erhöhen kann.
Die Experten betonen, dass ein Bronchodilatator bei den meisten Patienten ausreicht. Wenn der Patient mit dem Bronchodilatator zufrieden ist und eine Verbesserung der Lungenfunktion, der Symptome und der Leistungsfähigkeit spürt, kann die Therapie so beibehalten werden. Erst wenn die Luftnot weiterhin problematisch bleibt, sollte eine Kombination aus zwei Bronchodilatatoren erwogen werden. Auch der Wechsel zwischen verschiedenen Inhalationsgeräten ist möglich, falls die Handhabung Schwierigkeiten bereitet.
Wann ist ein inhalatives Steroid wirklich sinnvoll?
Bei Patienten mit häufigen Exazerbationen wird empfohlen, zwei Bronchodilatatoren zu kombinieren. Neuere Erkenntnisse zeigen jedoch, dass ein inhalatives Steroid (ICS) erst dann zusätzlich eingesetzt werden sollte, wenn eine Bluteosinophilie (erhöhte Anzahl von Eosinophilen im Blut) vorliegt. Patienten mit wiederkehrenden Exazerbationen und erhöhter Bluteosinophilie profitieren am meisten von einer ICS-Therapie. Für eine spezielle Untergruppe mit chronischer Bronchitis und FEV1< 50 % kann zusätzlich Roflumilast (ein entzündungshemmendes Medikament) eingesetzt werden. Bei ehemaligen Rauchern ist Azithromycin (ein Antibiotikum mit entzündungshemmender Wirkung) eine Option zur Senkung der Exazerbationsrate.
Die Entscheidung, ein ICS einzusetzen, sollte also immer individuell getroffen werden. Besonders Patienten ohne Exazerbationen und ohne Bluteosinophilie profitieren kaum von einer ICS-Therapie. Für diese Gruppe ist es sicher, das ICS abzusetzen. Bei Patienten mit hoher Bluteosinophilie (≥ 300 Zellen/μl) besteht hingegen eine klare Empfehlung, das ICS beizubehalten. Für Patienten mit vielen Exazerbationen, aber ohne Bluteosinophilie, sind die Studienergebnisse uneinheitlich, sodass keine eindeutige Empfehlung ausgesprochen werden kann.
ICS absetzen: Was passiert mit der Lungenfunktion und den Symptomen?
Was geschieht, wenn ein COPD-Patient, der bereits ein ICS erhält, dieses wieder absetzt? Vier randomisiert-kontrollierte Studien haben diese Frage untersucht und wurden in einem systematischen Review zusammengefasst. Die Ergebnisse zeigen: Nur bei Patienten mit hoher Bluteosinophilie (≥ 300 Zellen/μl) sollte das ICS unbedingt weitergeführt werden. Bei Patienten ohne Bluteosinophilie und ohne Exazerbationen kann das ICS sicher abgesetzt werden, ohne dass sich FEV1, Exazerbationen oder Symptome verschlechtern. Für Patienten mit vielen Exazerbationen, aber ohne Bluteosinophilie, gibt es keine eindeutige Empfehlung, da die Studien unterschiedliche Ergebnisse zeigen.
Zur Veranschaulichung wurde die „number needed to treat“ (NNT, Anzahl zu behandelnder Patienten, um ein Ereignis zu verhindern) herangezogen: Bei Patienten mit ≥ 300 Eos/μl müssen nur 9 Personen mit ICS behandelt werden, um eine Exazerbation zu verhindern. Bei Patienten mit weniger als 300 Eos/μl liegt die NNT bei 46 – das heißt, es müssen 46 Patienten behandelt werden, um eine Exazerbation zu vermeiden. Das unterstreicht, wie wichtig es ist, die ICS-Therapie gezielt einzusetzen und nicht pauschal zu verschreiben.
Jens Dehn
Quellen
- FomF WebUp Pneumologie, 7.12.2020; www.fomf.ch/webup/pneumologie-6-highlights-60-min-07-12-20.
- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 2021 Report; https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2020/11/GOLD-REPORT-2021-v1.1-25Nov20_WMV.pdf.
- Grewe FA, Sievi NA, Bradicich M, et al.: Compliance of Pharmacotherapy with GOLD Guidelines: A Longitudinal Study in Patients with COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2020; 15: 627–635; doi: 10.2147/COPD.S240444.
- Chalmers JD, Laska IF, Franssen FME, et al.: Withdrawal of inhaled corticosteroids in COPD: a European Respiratory Society guideline. Eur Respir J 2020; 55: 2000351; doi: 10.1183/13993003.00351-2020.

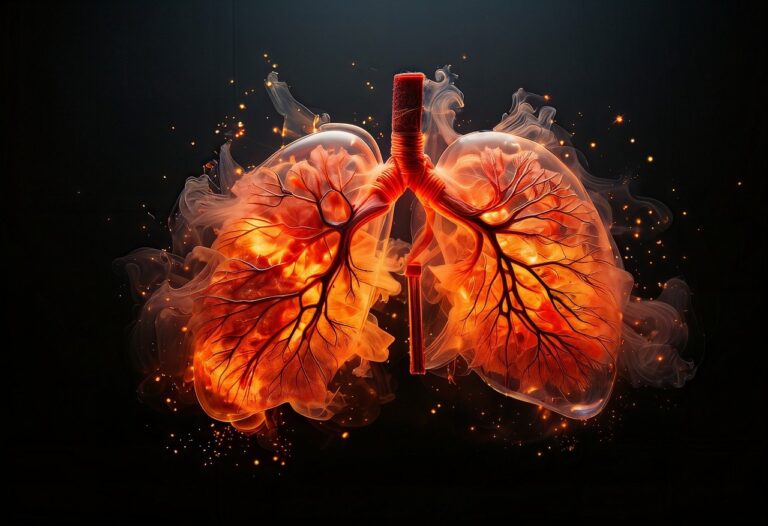


Comments are closed.