Es wird empfohlen, alle Patienten mit Diabetes routinemässig auf das Vorliegen einer CKD zu screenen. Neben der Messung der glomerulären Filtrations-rate (eGFR) beinhaltet dies auch die Bestimmung der Albumin-Kreatinin-Ratio (UACR). Typ-2-Diabetiker mit CKD profitieren nachweislich von einer Therapie mit einem SGLT-2-Inhibitor und/oder Finerenon, da die Progredienz der Niereninsuffizienz gebremst und das kardiovaskuläre Risiko reduziert wird.
Diabetes ist eine der häufigsten Ursachen einer chronischen Nierenerkrankung (chronic kidney disease, CKD). Dr. med. Julia Weinmann-Menke, Leiterin des Schwerpunkts Nephrologie, Universitätsmedizin Mainz, gab einen aktuellen Überblick zur Evidenzlage [1]. Definitionsgemäss spricht man von einer CKD, wenn eine seit mehr als 3 Monaten bestehende Anomalie der Nierenstruktur oder
-funktion vorliegt, welche Auswirkungen auf die Gesundheit hat [1,9]. Es wird empfohlen, Diabetiker mindestens einmal jährlich auf CKD zu screenen. Insbesondere in frühen Stadien ist die Niereninsuffizienz oft asymptomatisch. Wenn die eGFR im Normbereich liegt, bedeute dies nicht automatisch, dass der Patient nierengesund sei, betonte die Referentin [1]. Die Albuminurie ist ein früher Marker für Nephropathie und sagt das Risiko für Nierenversagen auch unabhängig von der eGFR voraus [9]. Die Bestimmung der Urin-Albumin-Kreatinin-Ratio (UACR) aus dem Spontanurin ist effizient und aussagekräftig. Auch im international geltenden CGA-Schema zur Klassifikation der CKD wird die Albuminurie mitberücksichtigt (C=Ursache/«cause», G=eGFR/«GFR category», A=Albuminurie/«Albuminuria category»). Die Bestimmung der Albuminurie sollte im Abstand von drei Monaten wiederholt werden. Wie man heute weiss, haben Typ-2-Diabetiker mit CKD ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko, sodass kardiorenale Protektion ein wichtiges Behandlungsziel ist.
SGLT-2-i und Finerenon sind evidenzbasierte Therapieoptionen
Die Stadieneinteilung gemäss CGA-Schema wurde von der KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) lanciert und ist für CKD-Patienten mit und ohne Diabetes anwendbar. Die geschätzte glomeruläre Filtrationsrate (eGFR) wird in die Stadien G1–G5 eingeteilt und die Albuminausscheidung im Spontanharn in A1 (<30 mg/g Kreatinin), A2 (30–300 mg/g) und A3 (>300 mg/g). Für die Behandlung einer CKD stehe heutzutage ein Arsenal an medikamentösen Therapieoptionen zur Verfügung, das nicht nur ACE-Hemmer (ACE-i) und RAAS-Inhibitoren (RAAS-i) einschliesst, sondern zusätzliche Möglichkeiten biete, erklärte die Referentin [1]. Zu SGLT-2-Inhibitoren (SGLT-i) und Finerenon gibt es eine beeindruckende Evidenzbasis. Drei der grossen Studien, die belegen, dass SGLT-2-i die Progredienz der CKD bremsen, sind DAPA-CKD, CREDENCE und EMPA-KIDNEY [2–4]. Im Ergebnis konnte unter Dapagliflozin, Canagliflozin und Empagliflozin bei Menschen mit CKD der zusammengesetzte renale Endpunkt signifikant reduziert werden [2–4] (Tab. 1). In die CREDENCE-Studie wurden ausschliesslich Typ-2-Diabetiker eingeschlossen, während in DAPA-CKD etwa 68% bzw. in EMPA-KIDNEY 46% der Teilnehmer Typ-2-Diabetes hatten; die übrigen Teilnehmer waren CKD-Patienten ohne Diabetes [2–4].

Der nichtsteroidale Mineralokortikoidrezeptor-Antagonist (MRA) Finerenon wurde in der FIDELIO-DKD-Studie bei Typ-2-Diabetikern mit eGFR 25–60 ml/min/1,73 m2 und Urin-Albumin-Kreatinin-Ratio von 30–300 mg/g untersucht [5]. Der primäre Endpunkt (Nierenversagen, mind. 4 Wochen anhaltender Abfall der eGFR um >40%, renaler Tod) wurde signifikant um 18% reduziert. Finerenon fungierte dabei als add-on zu bestehender ACE-i- oder ARB-Therapie. Diese renalen Ergebnisse wurden von einer zweiten kardiovaskulären Outcome-Studie (FIGARO) bestätigt [6] (Tab. 2). Mit FIDELITY liegt überdies eine gepoolte Analyse basierend auf FIDELIO-DKD und FIGARO-DKD vor [10]. Aktuell beschränkt sich die Zulassung von Finerenon auf CKD bei Typ-2-Diabetes.

Multifaktorielle Behandlung unter Einbezug von Lifestyle-Faktoren
In dem 2022 veröffentlichten Leitlinien-Update der KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes Clinical Practice Guideline) wird bei Diabetes und CKD ein ganzheitlicher Behandlungsansatz propagiert, um nieren- und kardiovaskulären Komplikationen entgegenzuwirken. [7,8]. Neben einer adäquaten medikamentösen Therapie beinhaltet dies auch Lebensstilmassnahmen wie gesunde Ernährung, Bewegung, Gewichtskontrolle und Nichtrauchen. Gemäss KDIGO sollen Patienten auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung achten mit einem hohen Anteil an Gemüse, Obst, Vollkornprodukten, Ballaststoffen, Hülsenfrüchten, pflanzlichen Proteinen und ungesättigten Fettsäuren. Es wird empfohlen, den Anteil an verarbeitetem Fleisch, raffinierten Kohlenhydraten und gesüssten Getränken zu reduzieren. Der Salzkonsum sollte weniger als 2 g/Tag betragen und die Proteinzufuhr 0,8 g/kg KG pro Tag. Für eine nachhaltige Ernährungsumstellung wird die Unterstützung durch einen entsprechend geschulten Ernährungsberater nahegelegt.
Patientenzentrierter Ansatz der kardiorenalen Risikoprotektion
Um Änderungen des Lebensstils sowie die Adhärenz bezüglich medikamentöser Therapie zu fördern, hat sich ein personalisierter Ansatz bewährt, was impliziert, dass Erklärungen abgegeben werden zum Therapierational bzw. den Behandlungszielen [9]. Typ-2-Diabetiker mit einer CKD haben ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Wobei die Kombination von Diabetes mit Erkrankungen von Herz und Nieren nicht nur das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse erhöht, sondern auch für kardiovaskulären Tod und Gesamt-Mortalität [9]. Zur Abschätzung des kardiovaskulären 10-Jahres-Risikos kann der SCORE-2 (Systematic COronary Risk Evaluation-2)-Diabetes eingesetzt werden [11]. Neben den bereits erwähnten medikamentösen Therapien und Lebensstilmassnahmen kann für Typ-2-Diabetiker mit CKD bis zu einer eGFR> 15 ml/min/1,73/m² auch der Einsatz eines GLP-1-Rezeptoragonisten erwogen werden. Ausserdem wird ein Blutdruckziel von ≤ 130/80 mmHg empfohlen, um das Risiko einer kardiovaskulären Erkrankung und einer Albuminurie zu verringern und im Weiteren hat sich eine intensive LDL-C-Senkung mit Statinen oder einer Statin-Ezetimib-Kombination als nützlich erwiesen [9].
Kongress: Diabetologie grenzenlos
Literatur:
- «Chronische Nierenerkrankung/Niereninsuffizienz», Session X – Organprotektion im Fokus, Prof. Dr. med. Julia Weinmann-Menke, Diabetologie grenzenlos, 02.–03.02.2024.
- Heerspink HJL, et al.: Dapagliflozin in patients with chronic kidney disease. N Engl J Med 2020; 383: 1436–1446.
- Perkovic V, et al.: Canagliflozin and renal outcomes in type 2 diabetes and nephropathy. N Engl J Med 2019; 380: 2295–2306.
- EMPA-KIDNEY Collaborative Group et al. Empagliflozin in patients with chronic kidney disease. N Engl J Med 2022 doi: 10.1056/NEJMoa2204233
- Bakris GL, et al.: FIDELIO-DKD investigators. Effect of finerenone on chronic kidney disease outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2020; 383: 2219–2229.
- Bakris GL, et al.: FIGARO DKD investigators. Cardiovascular events with finerenone in kidney disease and type 2 diabetes. N Engl J Med 2021; 385: 2252–2263.
- Wanner C, Busch M: Neue Leitlinie für das Diabetesmanagement bei chronischer Nierenerkrankung [New guideline on diabetes management in chronic kidney disease]. Inn Med (Heidelb) 2023; 64(3): 219–224.
- Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Clinical practice guideline for diabetes management in chronic kidney disease. Kidney Int 2022;102(5S): S1–S127.
- European Society of Cardiology (ESC), Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung (DGK) e.V.: ESC Pocket Guidelines, Version 2023. https://leitlinien.dgk.org/files/29_2023_
pocket-leitlinien_diabetes.pdf (letzter Abruf 01.03.2023). - Agarwal R, et al.: FIDELIO-DKD and FIGARO-DKD investigators. Cardiovascular and kidney outcomes with finerenone in patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease: the FIDELITY pooled analysis. Eur Heart J 2022; 43(6): 474–484.
- SCORE2 working group and ESC Cardiovascular risk collaboration SCORE2 risk prediction algorithms: new models to estimate 10-year risk of cardiovascular disease in Europe. Eur Heart J 2021; 42(25): 2439–2454.
HAUSARZT PRAXIS 2024; 19(4): 26–28 (veröffentlicht am 18.4.24, ahead of print)
InFo DIABETOLOGIE & ENDOKRINOLOGIE 2024; 1(2): 22–23
Autoren
- Mirjam Peter, M.Sc.
Publikation
- HAUSARZT PRAXIS
- INFO DIABETOLOGIE & ENDOKRINOLOGIE

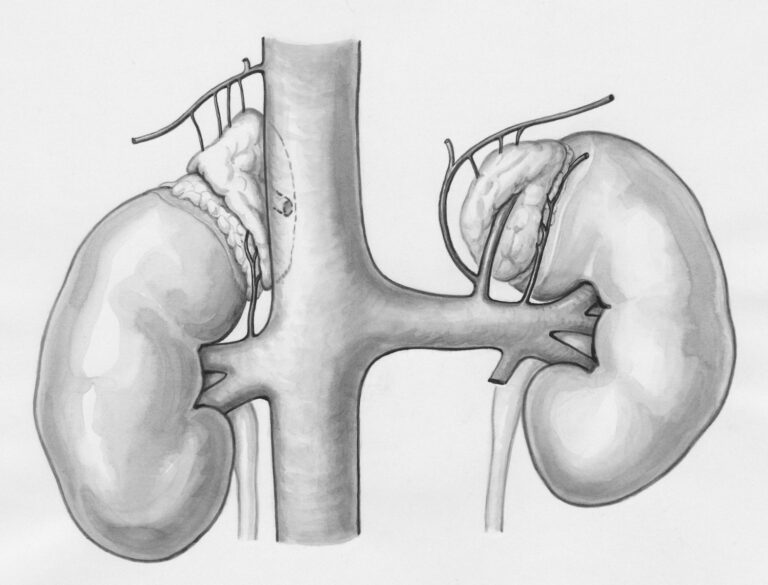


Comments are closed.