Schlaganfälle zählen zu den häufigsten und folgenschwersten Erkrankungen weltweit. Neue Forschungsergebnisse, vorgestellt auf der European Stroke Organisation Conference (ESOC), zeigen, wie innovative Ansätze wie die Polypille und gezielte Lebensstiländerungen das Risiko für einen Schlaganfall deutlich senken können. Dieser Artikel basiert auf InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE und fasst die wichtigsten Erkenntnisse für Patientinnen und Patienten verständlich zusammen.
Polypille und Lebensstil: Ein neuer Ansatz zur Schlaganfallprävention
Die European Stroke Organisation Conference (ESOC) feierte in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen und hat sich als bedeutende Plattform für die Präsentation bahnbrechender Studien etabliert. Besonders im Fokus stand die PROMOTE-Studie, die das Konzept der World Stroke Organisation für eine umfassende Primärprävention von Schlaganfällen untersucht. Ziel ist es, das Risiko für einen Schlaganfall in der Bevölkerung deutlich zu senken. Entwickelt wurde dieser Ansatz von Michael Brainin (Österreich) und Professor Valery Feigin (Neuseeland). Die Intervention kombiniert gezielte Lebensstiländerungen, unterstützt durch den sogenannten Stroke Riskometer (eine App zur individuellen Risikobewertung), mit einer Polypille. Diese Polypille enthält eine Kombination aus Blutdrucksenkern und Statinen, nämlich Valsartan 80 mg, Amlodipin 5 mg und Rosuvastatin 10 mg. Sie richtet sich an Menschen mit niedrigem bis mittlerem Schlaganfallrisiko, für die bisher keine medikamentöse Behandlung empfohlen wurde.
Die PROMOTE-Studie ist als randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-III-Studie konzipiert. Eingeschlossen wurden Teilnehmer im Alter von 50 bis 75 Jahren, die bislang keine Diagnose von Bluthochdruck (arterielle Hypertonie), Diabetes mellitus, Schlaganfall oder anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen hatten. Voraussetzung war ein systolischer Blutdruck (SBP) zwischen 120 und 139 mmHg sowie mindestens ein ungünstiger Lebensstilfaktor, wie ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht oder Rauchen. Ziel der Pilotstudie war es, die Umsetzbarkeit der Strategie, die Verträglichkeit der Polypille und die potenziellen Auswirkungen der kombinierten Intervention zu bewerten. Als Hauptergebnis wurde eine Senkung des SBP um 2,5 mmHg und eine Verbesserung des Life’s Simple 7-Scores (ein Bewertungssystem für kardiovaskuläre Gesundheit) um 0,4 Punkte innerhalb von 9 Monaten angestrebt.
Vor Beginn der Hauptstudie durchliefen die Teilnehmer eine 28-tägige Einführungsphase, um die Adhärenz (Einhaltung der Therapie) und Verträglichkeit der Polypille zu überprüfen. In Südbrasilien wurden Primärversorgungseinrichtungen nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen eingeteilt: Eine Gruppe erhielt eine vom Stroke Riskometer unterstützte Lebensstilberatung, die andere die Standardversorgung. Die einzelnen Teilnehmer wurden zusätzlich entweder der Polypille oder einem Placebo zugeordnet.
Ergebnisse der PROMOTE-Studie: Wirkung und Verträglichkeit der Polypille
An der Pilotstudie nahmen 371 Patientinnen und Patienten teil, das Durchschnittsalter lag bei 59 Jahren. 64% waren Frauen, 87% der Teilnehmenden waren weiß. Das durchschnittliche 10-Jahres-Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen betrug 4–5%. Die Polypille wurde insgesamt sehr gut vertragen: Lediglich 4% der Teilnehmer mussten nach der Einführungsphase aufgrund leichter Nebenwirkungen ausscheiden. Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse traten nur bei 1,4% der Patienten auf und standen nicht im Zusammenhang mit der Polypille.
Die Ergebnisse zeigten, dass der Blutdruck bei den Teilnehmern, die die Polypille erhielten, während der gesamten Studiendauer signifikant um 13 mmHg gesenkt werden konnte. Im Vergleich dazu lag die Blutdrucksenkung in der Placebogruppe nur bei 4 mmHg. Besonders ausgeprägt war die Senkung des Blutdrucks bei den Teilnehmern, die sowohl die Polypille einnahmen als auch den Stroke Riskometer nutzten. Darüber hinaus wurde bei den Polypillen-Nutzern eine Senkung des LDL-Cholesterins (Low-Density-Lipoprotein, das “schlechte” Cholesterin) um 38 mg/dl beobachtet. In der Placebogruppe zeigte sich hingegen kein Unterschied. Der Einsatz des Stroke Riskometers brachte zwar keinen zusätzlichen Nutzen bei der Cholesterinsenkung, aber 71% der Nutzer gaben an, dass ihnen die App geholfen habe, ihren Lebensstil zu verbessern.
Die Pilotstudie belegt, dass die neue Polypille nicht nur bei Menschen mit bereits bestehendem Bluthochdruck, sondern auch bei Personen mit niedrigerem Blutdruck und erhöhtem Schlaganfallrisiko wirksam und gut verträglich ist. Der Stroke Riskometer ist eine kostenfreie, einfach zu bedienende App, die Patientinnen und Patienten bei der Umsetzung gesunder Lebensstiländerungen unterstützen kann. Die Kombination aus medikamentöser und nicht-medikamentöser Prävention eröffnet somit neue Möglichkeiten, das Schlaganfallrisiko in der Bevölkerung nachhaltig zu senken.
Blutdrucksenkung bei akuter Hirnblutung: Der Faktor Zeit
Ein weiteres zentrales Thema auf der ESOC war die Bedeutung einer schnellen Blutdrucksenkung bei akuter intrazerebraler Blutung (ICH, eine Blutung im Gehirn). Die Ergebnisse von vier randomisierten, kontrollierten INTERACT-Studien zeigen, dass eine frühzeitige Senkung des Blutdrucks das Wachstum des Hämatoms (Bluterguss im Gehirn) deutlich verringern kann. In diesen Studien wurden die Daten von insgesamt 2921 Patientinnen und Patienten mit ICH ausgewertet. Verglichen wurde die Wirkung einer Blutdrucksenkung auf einen systolischen Wert von unter 180 mmHg versus unter 140 mmHg.
Für die Behandlung kamen standardisierte Protokolle zum Einsatz, sowohl für die intravenöse Gabe von blutdrucksenkenden Medikamenten als auch für die bildgebende Diagnostik (wie CT oder MRT). Ziel war es, herauszufinden, ob der Zeitpunkt des Therapiebeginns einen Einfluss auf das Hämatomwachstum hat. Die Ergebnisse sprechen klar für einen frühen Behandlungsbeginn: Je schneller die Blutdrucksenkung nach Auftreten der Hirnblutung eingeleitet wurde, desto geringer war das Risiko, dass das Hämatom weiter wächst. Besonders innerhalb der ersten drei Stunden nach Symptombeginn zeigte sich der größte Nutzen. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, bei Verdacht auf eine Hirnblutung sofort medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen und keine Zeit zu verlieren.
Für Patientinnen und Patienten bedeutet dies, dass eine rasche medizinische Versorgung und die schnelle Einleitung einer blutdrucksenkenden Therapie entscheidend für den Verlauf und die Prognose einer akuten Hirnblutung sind. Die Studienergebnisse zeigen, dass eine konsequente und frühzeitige Blutdruckkontrolle das Risiko für Komplikationen und bleibende Schäden deutlich senken kann.
Ischämische Fernkonditionierung: Neue Hoffnung bei akutem Schlaganfall
Ein innovativer Ansatz zur Behandlung des akuten ischämischen Schlaganfalls (ein Schlaganfall durch eine Durchblutungsstörung im Gehirn) ist die sogenannte ferngesteuerte ischämische Perkonditionierung (RIPerC). Dabei handelt es sich um eine Technik, bei der durch wiederholtes, kurzzeitiges Unterbrechen der Blutzufuhr in einer Gliedmaße (zum Beispiel durch eine Blutdruckmanschette am Arm) schützende Mechanismen im Körper aktiviert werden. Diese Methode soll das Gehirn während eines akuten Schlaganfalls vor weiteren Schäden schützen.
Im Rahmen des REMOTE-CAT-Projekts wurde eine multizentrische, doppelblinde Studie durchgeführt, um die Wirkung von RIPerC bei Patientinnen und Patienten mit akutem ischämischem Schlaganfall zu untersuchen. Die Intervention wurde bereits während des Transports im Krankenwagen zum Krankenhaus begonnen. Das primäre Ziel war, den Anteil der Patienten zu ermitteln, die 90 Tage nach dem Schlaganfall einen modifizierten Rankin-Score (mRS, ein Maß für die Behinderung nach Schlaganfall) von 2 oder weniger erreichten. Sekundär wurde das Infarktvolumen (Größe des abgestorbenen Hirngewebes) bewertet.
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass RIPerC insbesondere bei bestimmten Patientengruppen mit niedrigerem NIHSS-Wert (National Institutes of Health Stroke Scale, ein Maß für die Schwere des Schlaganfalls) und bei Patienten ohne großen Gefäßverschluss zu einer besseren funktionellen Erholung führen kann. Auch wenn noch weitere Untersuchungen notwendig sind, zeigt diese Studie, dass innovative Behandlungsansätze wie die ischämische Fernkonditionierung das Potenzial haben, die Prognose nach einem akuten Schlaganfall zu verbessern.
Soziale Faktoren beeinflussen das Schlaganfallrisiko und die Sterblichkeit
Neben medizinischen und therapeutischen Maßnahmen spielen auch soziale Faktoren eine entscheidende Rolle für das Risiko und die Prognose nach einem Schlaganfall. Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass Menschen mit höherem Einkommen ein um 32% geringeres Sterberisiko nach einem Schlaganfall haben. Auch ein höheres Bildungsniveau senkt das Sterberisiko um 26%. Diese Erkenntnisse stammen aus einer registerbasierten Studie, in der die Daten von 6901 Schlaganfallpatienten in Göteborg (Schweden) zwischen 2014 und 2019 analysiert wurden. Im Fokus standen vier sogenannte SDoH-Faktoren (Social Determinants of Health, also soziale Gesundheitsdeterminanten): Wohngegend, Geburtsland, Bildung und Einkommen.
Die Studie zeigte, dass bereits ein ungünstiger SDoH-Faktor das Sterberisiko um 18% erhöht. Bei zwei bis vier ungünstigen Faktoren stieg das Risiko sogar auf 24%. Zusätzlich wurde ein Zusammenhang zwischen einem erhöhten Sterberisiko und weiteren Risikofaktoren wie körperlicher Inaktivität, Diabetes mellitus, Alkoholmissbrauch und Vorhofflimmern (eine Herzrhythmusstörung) festgestellt. Besonders auffällig war, dass der Anteil weiblicher Patientinnen mit der Anzahl der ungünstigen SDoH-Faktoren zunahm: In der Gruppe ohne ungünstige Faktoren waren 41% weiblich, in der Gruppe mit zwei bis vier ungünstigen Faktoren lag der Anteil bei 59%. Auch das Rauchen, aktuell oder innerhalb des letzten Jahres, war in der Gruppe mit mehreren ungünstigen SDoH-Faktoren häufiger (19% gegenüber 12%).
Diese Ergebnisse verdeutlichen, wie wichtig es ist, nicht nur medizinische, sondern auch soziale Aspekte bei der Prävention und Nachsorge von Schlaganfällen zu berücksichtigen. Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen Rahmenbedingungen, wie der Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung, können einen wichtigen Beitrag zur Senkung des Schlaganfallrisikos und zur Verbesserung der Überlebenschancen leisten.
Fazit: Schlaganfallprävention ist vielfältig und individuell
Die aktuellen Studienergebnisse zeigen, dass die Prävention und Behandlung von Schlaganfällen auf mehreren Ebenen ansetzen muss. Die Kombination aus medikamentösen Ansätzen wie der Polypille, gezielten Lebensstiländerungen und der Berücksichtigung sozialer Faktoren bietet neue Chancen, das Risiko für einen Schlaganfall nachhaltig zu senken. Besonders wichtig ist die frühzeitige Erkennung und Behandlung von Risikofaktoren wie Bluthochdruck und erhöhtem Cholesterin. Innovative Methoden wie die ischämische Fernkonditionierung könnten in Zukunft die Therapieoptionen erweitern. Gleichzeitig sollten Patientinnen und Patienten ermutigt werden, aktiv an ihrer Gesundheit mitzuwirken – sei es durch die Nutzung von Apps wie dem Stroke Riskometer, die Umsetzung gesunder Lebensgewohnheiten oder die Wahrnehmung von Vorsorgeuntersuchungen. Auch die Politik und das Gesundheitssystem sind gefordert, soziale Ungleichheiten abzubauen und allen Menschen den Zugang zu Prävention und Therapie zu ermöglichen.
Quellen
- Polypill and risikometer to prevent stroke and cognitive impairment in primary health care – final results of the promote pilot study. Presented at the European Stroke Organisation Conference; 15 May 2024; Basel, Switzerland.
- Timing of BP lowering to mitigate hematoma expansion in intracerebral hemorrhage: IPD pooled analysis of 4 interact trials. Presented at the European Stroke Organisation Conference; 16 May 2024; Basel, Switzerland.
- Remote ischemic perconditioning among acute ischemic stroke patients in Catalonia: remote-cat project. Presented at the European Stroke Organisation Conference; 17 May 2024; Basel, Switzerland.
- A register-based study on associations between stroke mortality and risk factors including social determinants of health. Presented at the European Stroke Organisation Conference; 15 May 2024; Basel, Switzerland.



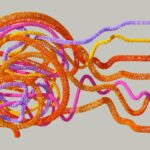
Comments are closed.