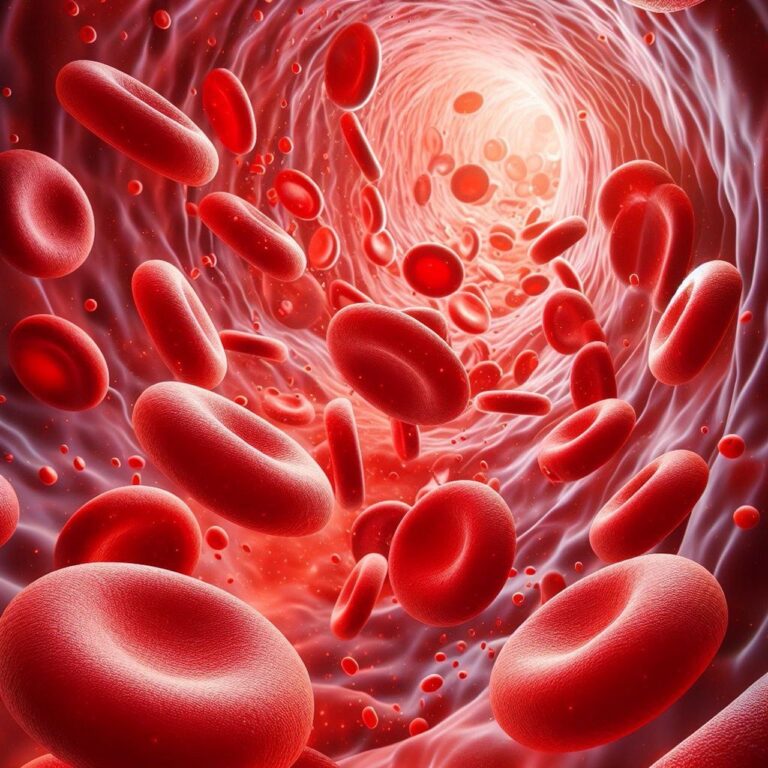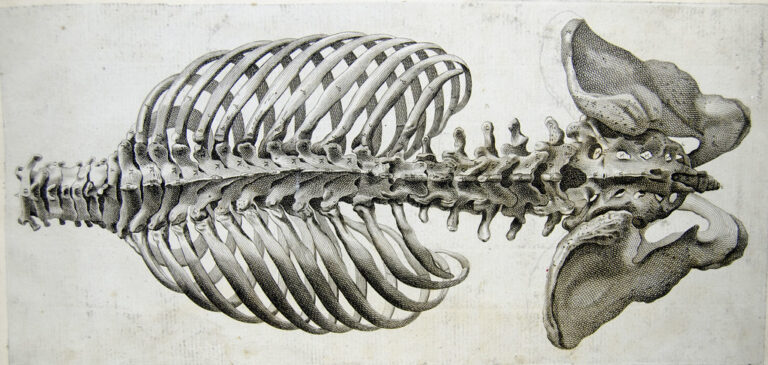Viele Frauen mit Epilepsie wünschen sich Kinder und fragen sich, ob ihre Erkrankung oder die notwendige medikamentöse Behandlung eine Schwangerschaft erschweren oder Risiken für Mutter und Kind bedeuten. Dieser Artikel basiert auf INFO NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE und gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Aspekte rund um Epilepsie und Kinderwunsch, von der Planung über die Schwangerschaft bis zur Geburt und Stillzeit. Sie erfahren, welche Risiken bestehen, wie die Therapie angepasst werden kann und worauf Sie gemeinsam mit Ihrem Arzt achten sollten.
Epilepsie und Kinderwunsch: Grundlegende Überlegungen
Epilepsie ist eine chronische neurologische Erkrankung, bei der es zu wiederkehrenden epileptischen Anfällen kommt. Viele Frauen mit Epilepsie stehen irgendwann vor der Frage, ob sie trotz ihrer Erkrankung eine Familie gründen können. Die gute Nachricht ist: Die meisten Schwangerschaften bei Epilepsie verlaufen ohne größere Komplikationen, und die Mehrheit der Kinder epilepsiekranker Mütter wird gesund geboren und entwickelt sich altersgerecht. Dennoch gibt es einige spezifische Herausforderungen, die im Rahmen eines gezielten Schwangerschaftsmanagements gemeinsam mit dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin besprochen werden sollten.
Wichtig ist, dass das Vorliegen einer Epilepsie kein Grund sein sollte, auf eigene Kinder zu verzichten. Die Risiken sind in den meisten Fällen überschaubar, wenn eine gute medizinische Betreuung und eine individuelle Therapieanpassung erfolgen. Besonders im Fokus steht dabei die Situation der Mutter, da das ungeborene Kind während der Schwangerschaft ausschließlich den Medikamenten und Anfällen der Mutter ausgesetzt ist. Auch wenn bei Männern mit Epilepsie die Fruchtbarkeit durch die Erkrankung oder die Medikamente beeinträchtigt sein kann, und das Risiko für Epilepsie beim Kind leicht erhöht ist, steht die Behandlung und Beratung der werdenden Mutter im Vordergrund.
Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte rund um Epilepsie und Kinderwunsch chronologisch dargestellt: von der Zeit vor der Schwangerschaft über die Schwangerschaft selbst bis hin zur Geburt und der Zeit danach. Ziel ist es, Ihnen als Patientin und Ihren Angehörigen eine verständliche und fundierte Orientierung zu geben, damit Sie gemeinsam mit Ihrem Behandlungsteam die bestmöglichen Entscheidungen treffen können.
Fertilität und Vererbungsrisiko bei Epilepsie
Die weibliche Fruchtbarkeit (Fertilität) kann durch Epilepsie und die Einnahme von Antikonvulsiva (Medikamente zur Anfallsverhinderung) um etwa 15–30% reduziert sein. Dies geschieht über verschiedene Mechanismen, zum Beispiel durch hormonelle Veränderungen oder direkte Auswirkungen der Medikamente auf den Zyklus. Dennoch werden Frauen mit Epilepsie, die sich ein Kind wünschen und keine bekannte Fertilitätsstörung haben, im Durchschnitt nicht später schwanger als gesunde Frauen. In den meisten Fällen kann eine Schwangerschaft also wie gewünscht erreicht werden.
Vor einer geplanten Schwangerschaft möchten viele Frauen wissen, wie hoch das Risiko ist, dass ihr Kind ebenfalls an Epilepsie erkrankt. Bei seltenen monogenen Epilepsien (Epilepsien, die durch eine Veränderung in einem einzelnen Gen verursacht werden) kann das Vererbungsrisiko deutlich erhöht sein. In solchen Fällen wird eine spezielle humangenetische Beratung empfohlen, um das individuelle Risiko besser einschätzen zu können. Bei den meisten anderen Epilepsieformen ist das Risiko für das Kind jedoch vergleichsweise gering: Etwa 4–5% der Kinder von Frauen mit Epilepsie entwickeln ebenfalls eine Epilepsie. Bei sogenannten erworbenen Epilepsien (zum Beispiel nach einer Hirnverletzung oder Entzündung) ist das Risiko noch niedriger, während es bei idiopathischen Epilepsien (Epilepsien ohne erkennbare Ursache) auf maximal etwa 10% ansteigt.
Auch bei Männern mit Epilepsie kann die Fruchtbarkeit durch die Erkrankung oder die Medikamente beeinträchtigt sein, und das Risiko für Epilepsie beim Kind ist leicht erhöht. Allerdings ist das ungeborene Kind während der Schwangerschaft ausschließlich den Medikamenten und Anfällen der Mutter ausgesetzt. Daher liegt der Schwerpunkt der Beratung und Therapieanpassung auf der werdenden Mutter.
Mütterliche Gesundheitsrisiken und Anfallsrisiko in der Schwangerschaft
Frauen mit Epilepsie haben im Vergleich zu gesunden Frauen ein leicht erhöhtes Risiko für bestimmte Komplikationen während der Schwangerschaft. Dazu gehören Spontanaborte (Fehlgeburten), vor- und nachgeburtliche Blutungen, arterielle Hypertonie (Bluthochdruck) und eine Entbindung vor der 37. Schwangerschaftswoche (Frühgeburt). Besonders bei Frauen, die mit Antikonvulsiva behandelt werden, ist das Risiko für nachgeburtliche Blutungen etwas erhöht. In älteren Studien konnte jedoch kein eindeutig erhöhtes Risiko für Schwangerschaftshypertonie, Präeklampsie (eine spezielle Form des Schwangerschaftsbluthochdrucks), perinatalen Kindstod oder Status epilepticus (ein besonders schwerer, anhaltender epileptischer Anfall) nachgewiesen werden. Allerdings wurde in einzelnen Studien ein vermehrtes Auftreten von Gestationsdiabetes (Schwangerschaftsdiabetes) beobachtet.
Das Anfallsrisiko während der Schwangerschaft bleibt bei etwa 54–80% der Frauen mit Epilepsie unverändert. Spontane Verbesserungen der Anfallssituation werden je nach Studie bei 3–24% der Frauen beobachtet, während sich bei 14–32% die Anfallssituation verschlechtert. Häufig sind Verschlechterungen auf eigenmächtige Dosisreduktionen oder das Absetzen der Antikonvulsiva zurückzuführen. Auch in der Schwangerschaft ist die Anfallssituation bei unbehandelten Epilepsien ungünstiger als bei behandelten Epilepsien.
Ein besonders wichtiger Punkt ist das Risiko für Fehlbildungen beim Kind durch die Einnahme von Antikonvulsiva. Bei einer medikamentösen Behandlung mit geringem teratogenem Risiko (Teratogenität bedeutet die Fähigkeit eines Stoffes, Fehlbildungen beim ungeborenen Kind zu verursachen) kann das Fehlbildungsrisiko im Vergleich zu unbehandelten Epilepsien vermieden werden. Die Anfallsfreiheit der Mutter bleibt auch in der Schwangerschaft das wichtigste Therapieziel. Daher wird den meisten Patientinnen geraten, die antikonvulsive Therapie während der Schwangerschaft fortzuführen. Bei anfallsfreien Patientinnen kann vor einer geplanten Schwangerschaft eine Dosisreduktion oder ein Absetzen der Medikamente nach individueller Einschätzung des Rückfallrisikos diskutiert werden.
Besonders bei Monotherapien (Behandlung mit nur einem Medikament) mit Valproat, Lamotrigin oder Carbamazepin ist eine Dosisreduktion von Interesse, da für diese Wirkstoffe ein dosisabhängiger Anstieg der Fehlbildungsraten nachgewiesen wurde. Besonders deutlich ist dieser Effekt bei Valproat: Bei Dosen bis 600 mg pro Tag liegt die Fehlbildungsrate deutlich unter 10%, während sie bei hohen Dosen von 1500 mg und mehr auf über 20% ansteigen kann. Vor Eintritt einer Schwangerschaft sollte die Anfallsfreiheit oder bestmögliche Anfallskontrolle für mindestens sechs Monate dokumentiert werden. Bei Antikonvulsiva mit dosisabhängiger Teratogenität sollte vor der Schwangerschaft die geringstmögliche Dosis angestrebt werden, ebenfalls mit mindestens sechs Monaten stabiler Medikation vor der Empfängnis. Wenn vor Eintritt der Schwangerschaft über 9–12 Monate Anfallsfreiheit bestand, ist die Chance sehr hoch (84–92%), dass dies auch während der Schwangerschaft so bleibt.
Medikamentöse Therapie bei Kinderwunsch und in der Schwangerschaft
Die Auswahl des Antikonvulsivums oder der Kombination mehrerer Wirkstoffe richtet sich neben der individuellen Wirksamkeit vor allem nach dem teratogenen Risiko. Bei Frauen mit Epilepsie, die mit Medikamenten behandelt werden, ist das Risiko für Fehlbildungen beim Kind im Vergleich zu gesunden, unbehandelten Frauen bis auf das Dreifache erhöht. Besonders hohe Fehlbildungsraten unter Monotherapie (Behandlung mit nur einem Wirkstoff) wurden für Valproat (je nach Studie und Dosis bis weit über 10%), Primidon und in geringerem Maße für Phenobarbital und – mit unterschiedlichen Ergebnissen – Phenytoin beobachtet.
Neuere Antikonvulsiva wie Lamotrigin, Levetiracetam und Oxcarbazepin zeigen erfreulich niedrige Fehlbildungsraten von etwa 2–4%. Allerdings können auch bei diesen Wirkstoffen bei hohen Dosierungen die Fehlbildungsraten in den höheren einstelligen Prozentbereich ansteigen. Andere neue Antikonvulsiva wie Perampanel oder Brivaracetam können derzeit für den Einsatz in der Schwangerschaft nicht empfohlen werden, da entweder noch keine ausreichenden Daten vorliegen oder Hinweise auf mögliche Risiken bestehen.
Bei Frauen, die mit einer Kombinationstherapie (Polytherapie) gut eingestellt sind, stellt sich die Frage, ob für die Schwangerschaft auf eine Monotherapie umgestellt werden sollte. Ältere Studien zeigten, dass die Fehlbildungsrate mit der Anzahl der eingesetzten Wirkstoffe deutlich anstieg. Neuere Untersuchungen deuten darauf hin, dass insbesondere Kombinationen, die Valproat enthalten, mit einem erhöhten Fehlbildungsrisiko verbunden sind. Kombinationen ohne Valproat, zum Beispiel mit Carbamazepin oder Lamotrigin, zeigen im Vergleich zu Monotherapien meist keine signifikant erhöhten Raten. Dennoch gibt es Hinweise, dass Polytherapien auch die kognitive Entwicklung (geistige Entwicklung) der Kinder negativ beeinflussen können, wobei dies vor allem für Valproat nachgewiesen wurde. Künftig sollten daher Polytherapien ohne Valproat in Bezug auf die kindliche Kognition genauer untersucht werden.
Einige Ärzte empfehlen, hohe Tagesdosen von Antikonvulsiva auf drei Einzeldosen zu verteilen, um Spitzenwerte im Blut zu vermeiden, die das Fehlbildungsrisiko erhöhen könnten. Ein klarer klinischer Nutzen dieser Maßnahme konnte bisher jedoch nicht nachgewiesen werden. Zudem besteht bei einer zusätzlichen Mittagsdosis ein erhöhtes Risiko, die Einnahme zu vergessen, was insbesondere bei berufstätigen Frauen relevant sein kann.
Valproat und andere Antikonvulsiva in der Schwangerschaft
Valproat ist ein Antikonvulsivum, das besonders wirksam bei bestimmten Epilepsieformen ist, aber mit einem hohen Risiko für Fehlbildungen und negativen Auswirkungen auf die kindliche kognitive Entwicklung verbunden ist. Die Evidenz für eine dosisabhängige schädliche Wirkung von Valproat auf die geistige Entwicklung des Kindes ist mittlerweile eindeutig. Auch im Vergleich mit anderen, als kognitiv weitgehend unbedenklich geltenden Wirkstoffen wie Levetiracetam, Lamotrigin und Carbamazepin schneidet Valproat schlechter ab. Zudem kann die Einnahme von Valproat während der Schwangerschaft das Risiko für autistische Züge beim Kind erhöhen.
Angesichts dieser Risiken wird heute von Fachgesellschaften empfohlen, Valproat bei gebärfähigen Frauen nur noch in Ausnahmefällen einzusetzen. Eine solche Ausnahme liegt zum Beispiel vor, wenn bei einer idiopathischen generalisierten Epilepsie nur mit Valproat Anfallsfreiheit erreicht werden kann. Ist eine Schwangerschaft bereits eingetreten und die Patientin ist mit Valproat gut eingestellt, wird meist kein Medikamentenwechsel mehr vorgenommen, da sowohl der Wechsel auf ein anderes Medikament als auch das vollständige Absetzen von Valproat das Risiko für generalisierte tonisch-klonische Anfälle erhöht. Diese Anfälle wiederum sind ein negativer Prädiktor für die spätere schulische Entwicklung des Kindes.
Aufgrund der Komplexität der Situation wird empfohlen, für Entscheidungen über Valproattherapien bei Frauen im gebärfähigen Alter standardisierte Aufklärungsformulare und Informationsbroschüren zu verwenden. Für die Schweiz sind solche Materialien beispielsweise über www.swissmedic.ch verfügbar. Bei anderen Antikonvulsiva wie Carbamazepin, Lamotrigin und Levetiracetam ist das Fehlbildungsrisiko deutlich geringer, insbesondere bei niedrigen Tagesdosen. Dennoch sollten auch hier die individuellen Risiken und Vorteile sorgfältig abgewogen werden.
Für viele Frauen mit Epilepsie ist es beruhigend zu wissen, dass eine Schwangerschaft auch unter medikamentöser Behandlung in den meisten Fällen problemlos verläuft. Wichtig ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Patientin, Gynäkologin und Epileptologin, um die Therapie optimal auf die individuellen Bedürfnisse abzustimmen und Risiken zu minimieren.
Kindliche Gesundheitsrisiken und Folsäuresupplementation
Ein Risiko für das ungeborene Kind besteht vor allem durch schwere mütterliche Anfälle, insbesondere generalisierte tonisch-klonische Anfälle. Einzelne Anfälle schaden dem Kind wahrscheinlich nicht unmittelbar, da das fetale Hämoglobin (der rote Blutfarbstoff des ungeborenen Kindes) Sauerstoff besonders gut bindet und so einen gewissen Schutz bietet. Dennoch wurde beobachtet, dass Kinder von Müttern, die während der Schwangerschaft generalisierte tonisch-klonische Anfälle erleiden, häufiger zu früh geboren werden und ein geringeres Geburtsgewicht aufweisen. Das Risiko für hypoxiebedingte Schäden (Schäden durch Sauerstoffmangel) bei sehr schweren oder lang anhaltenden Anfällen ist nicht eindeutig belegt.
Kinder epilepsiekranker Frauen haben insgesamt ein erhöhtes Risiko für einen niedrigen Apgar-Score (ein Wert, der den Gesundheitszustand des Neugeborenen unmittelbar nach der Geburt bewertet) und ein geringes Geburtsgewicht. Das Risiko für intrauterinen Tod (Tod des Kindes im Mutterleib) kann bei Polytherapie erhöht sein, während dies für Monotherapien nicht klar nachgewiesen ist. Auch das Risiko für fetale Wachstumsstörungen ist bei Frauen mit Epilepsie etwas höher als bei gesunden Frauen, insbesondere bei medikamentös behandelter Epilepsie.
Bestimmte Fehlbildungen, sogenannte “große Malformationen” (gesundheitlich oder kosmetisch relevante Fehlbildungen an Herz, Urogenitalsystem, Nervensystem, Gesicht und Gliedmaßen), werden durch bestimmte medikamentöse Behandlungskonstellationen begünstigt. So treten zum Beispiel kardiale Fehlbildungen häufiger unter Phenobarbital auf, während Spaltbildungen (wie Lippen-Kiefer-Gaumenspalten) unter Valproat vermehrt beobachtet werden. Ob die Epilepsie selbst das Fehlbildungsrisiko erhöht, ist umstritten. In einer großen Metaanalyse konnte eine erhöhte Fehlbildungsrate bei unbehandelten Epilepsien nicht nachgewiesen werden. Kleinere, meist nicht korrekturbedürftige Malformationen wie diskrete Dysmorphien oder Mikrozephalie (zu kleiner Kopf) treten möglicherweise auch unabhängig von der Medikation bei Kindern von Eltern mit Epilepsie häufiger auf.
Eine wichtige Maßnahme zur Risikoreduktion ist die Supplementation mit Folsäure. Es gibt Hinweise darauf, dass die Einnahme von 0,4–5 mg Folsäure pro Tag, beginnend bereits vor der Empfängnis und bis zum Ende des ersten Schwangerschaftsdrittels, die Fehlbildungsrate senken kann. In der Epileptologie hat sich eine Supplementation mit 5 mg pro Tag etabliert, auch wenn der spezifische Nutzen dieser hohen Dosis schwer nachweisbar ist. Neuere Studien deuten darauf hin, dass Folsäuresupplementation auch das Risiko für autistische Züge beim Kind senken und einen positiven Einfluss auf die spätere Intelligenzentwicklung haben könnte.
Dosisanpassungen der Antikonvulsiva und Überwachung während der Schwangerschaft
Während der Schwangerschaft verändern sich die Hormonspiegel und die Pharmakokinetik (Aufnahme, Verteilung, Abbau und Ausscheidung von Medikamenten) im Körper. Dadurch kann es zu einer relevanten Abnahme der Serumkonzentrationen bestimmter Antikonvulsiva kommen, was das Risiko für Anfallsrezidive (Wiederauftreten von Anfällen) erhöht. Besonders betroffen sind Lamotrigin, Levetiracetam, Oxcarbazepin, Phenytoin, Phenobarbital, Topiramat und Zonisamid. Bei Lamotrigin kommt es zusätzlich durch eine verstärkte Glucuronidierung (ein Abbauprozess, der durch das Hormon Östrogen aktiviert wird) zu einem schnelleren Abbau, sodass oft schrittweise Dosiserhöhungen bis etwa zur doppelten Ausgangsdosis erforderlich sind, um die gewünschte Serumkonzentration zu erhalten.
Da die Hochdosistherapie meist erst im zweiten oder dritten Schwangerschaftsdrittel notwendig wird, sind solche Dosiserhöhungen in der Regel vertretbar. Die individuell anzustrebende Serumkonzentration kann häufig aus der Krankengeschichte abgeleitet werden, zum Beispiel aus den Werten, die bei früheren Anfällen oder in Phasen der Anfallsfreiheit gemessen wurden. Diese Werte dienen dann als Richtwert für die Therapieanpassung während der Schwangerschaft.
Generell sollte eine Schwangerschaft bei Epilepsie als Risikoschwangerschaft eingestuft werden. Das bedeutet, dass engmaschige Kontrollen durch Gynäkologin oder Geburtshelferin erfolgen sollten, einschließlich spezieller Ultraschalluntersuchungen (Feinultraschall) zu den vorgesehenen Zeitpunkten. So können mögliche Komplikationen frühzeitig erkannt und behandelt werden.
Geburt, Postpartalperiode und Stillzeit bei Epilepsie
Das Anfallsrisiko ist rund um die Geburt (peripartal) bei Frauen mit Epilepsie leicht erhöht. Faktoren wie Schlafmangel, unregelmäßige Medikamenteneinnahme sowie emotionale und körperliche Belastungen spielen dabei eine Rolle. Eine routinemäßige Gabe von zusätzlicher antikonvulsiver Medikation während der Geburt wird jedoch nicht empfohlen, es sei denn, es liegt bereits eine sehr hohe Anfallsfrequenz vor.
Der Geburtsmodus (zum Beispiel spontane Geburt oder Kaiserschnitt) kann in der Regel nach den üblichen geburtshilflichen Kriterien gewählt werden. Eine Epilepsie allein ist kein Grund für einen Kaiserschnitt. Nur bei sehr hoher Anfallsfrequenz oder bekannter Neigung zu Status epilepticus kann ein Kaiserschnitt aus epileptologischer Sicht sinnvoll sein.
Nach der Geburt sollten die Serumkonzentrationen der mütterlichen Antikonvulsiva überprüft werden, insbesondere wenn während der Schwangerschaft Dosisanpassungen vorgenommen wurden. Die Konzentrationen von Lamotrigin, Levetiracetam und anderen zuvor erhöhten Wirkstoffen können in den ersten Wochen nach der Geburt stark ansteigen, was zu Überdosierungserscheinungen bei der Mutter und – im Falle des Stillens – auch beim Kind führen kann. Ein fester Zeitplan für die Dosisreduktion nach der Geburt lässt sich nicht vorgeben, da die individuellen Verläufe sehr unterschiedlich sind. Bewährt hat sich, die letzte vor der Geburt eingenommene Dosis in den ersten zwei Tagen nach der Geburt beizubehalten und dann schrittweise entsprechend den Serumkonzentrationen zu reduzieren.
Im häuslichen Umfeld können die meisten Frauen mit Epilepsie ihr Neugeborenes selbstständig versorgen, sofern sie diese Rolle in der Familie übernehmen möchten. Zu strenge Einschränkungen in der Betreuung belasten die Mutter-Kind-Beziehung unnötig. Dennoch sollten vor allem bei nicht anfallsfreien Müttern einige einfache Verhaltensregeln zur Unfallverhütung beachtet werden: Das Kind sollte nicht ohne Begleitung gebadet werden (Ertrinkungsgefahr bei Anfällen), Wickeln sollte vorsichtshalber am Boden erfolgen (Sturzgefahr vom Wickeltisch), und das Tragen des Kindes auf dem Arm sollte möglichst im Sitzen erfolgen (Sturzgefahr bei Anfällen).
Vitamin-K-Gaben an das Neugeborene werden nach den aktuellen Empfehlungen durchgeführt. Eine zusätzliche Gabe von Vitamin K an die Schwangere ist nur bei bestimmten Kombinationstherapien mit mehreren Enzyminduktoren oder bei vorzeitiger Entbindung vor der 37. Schwangerschaftswoche aus epileptologischer Sicht angezeigt.
Stillen bei Epilepsie: Vorteile und mögliche Risiken
Auch Frauen mit Epilepsie, die medikamentös behandelt werden, können ihre Kinder in der Regel stillen. Die verschiedenen Antikonvulsiva unterscheiden sich jedoch stark hinsichtlich der zu erwartenden Serumkonzentrationen beim Kind. Diese lassen sich nicht einfach aus den Konzentrationen in der Muttermilch ableiten, da auch der kindliche Stoffwechsel eine Rolle spielt. Relativ hohe Serumkonzentrationen beim Kind können beim Stillen unter Phenobarbital, Primidon und Ethosuximid auftreten, in geringerem Maße auch unter Lamotrigin und möglicherweise unter Zonisamid.
Die Datenlage zu den klinischen Auswirkungen des Stillens bei medikamentös behandelten Epilepsien ist insgesamt noch unzureichend. Als sicher oder empfehlenswert gelten vor allem Wirkstoffe, deren Pharmakokinetik gut bekannt und unproblematisch ist und für die bei einer ausreichenden Zahl von Untersuchten keine oder nur geringe unerwünschte Effekte (wie Sedierung, Trinkschwäche oder fehlende Gewichtszunahme) bei den Säuglingen berichtet wurden. In aktuellen Übersichten werden Levetiracetam, Carbamazepin, Phenobarbital, Primidon und Valproat als weitgehend unproblematisch eingestuft, Lamotrigin, Oxcarbazepin, Phenytoin, Ethosuximid, Vigabatrin, Topiramat, Pregabalin, Gabapentin und Zonisamid als mit Vorbehalt einsetzbar, und Clobazam, Mesuximid, Rufinamid, Felbamat, Lacosamid, Sultiam und Perampanel als nicht empfehlenswert.
Es ist jedoch zu beachten, dass viele der als unproblematisch eingestuften Wirkstoffe (wie Primidon, Phenobarbital, Phenytoin) heute kaum noch eingesetzt werden oder in der Schwangerschaft ohnehin nicht empfohlen werden (wie Valproat, Topiramat), sodass sie vermutlich auch in der Stillzeit selten zur Anwendung kommen. Dass ein Wirkstoff als “sicher” oder “kompatibel” bewertet wird, bedeutet also nicht zwangsläufig, dass er speziell für die Stillzeit empfohlen wird.
Die Datenlage zu möglichen negativen kognitiven Effekten auf das Kind durch die Aufnahme von Antikonvulsiva über die Muttermilch ist noch nicht ausreichend. In bisherigen Studien konnten eher positive als negative Effekte des Stillens unter den häufig eingesetzten Antikonvulsiva festgestellt werden. Auch ein zusätzlicher negativer Effekt von Valproat für eine durch die Stillzeit verlängerte Exposition wurde nicht beobachtet.
Fazit und praktische Empfehlungen für Patientinnen
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine unproblematische Schwangerschaft und eine gute Entwicklung des Kindes auch bei Frauen mit Epilepsie die Regel sind. Die wichtigsten Voraussetzungen dafür sind eine individuelle Therapieplanung, eine enge Zusammenarbeit zwischen Patientin, Gynäkologin und Epileptologin sowie eine frühzeitige Beratung und Anpassung der Medikation. Die Planung beginnt idealerweise schon vor der Empfängnis, mit der Einstellung auf eine möglichst schwangerschaftsverträgliche Medikation und dem Beginn einer Folsäuresupplementation.
Die wichtigsten Empfehlungen für Frauen mit Epilepsie und Kinderwunsch sind:
- Die meisten Schwangerschaften verlaufen bei Epilepsie problemlos, wenn eine adäquate Therapieplanung und Überwachung erfolgen.
- Vor einer geplanten Schwangerschaft sollte eine möglichst niedrig dosierte antikonvulsive Medikation etabliert werden, wobei die Anfallsfreiheit der Mutter das wichtigste Therapieziel bleibt.
- Wenn möglich, sollten Therapien mit Valproat vermieden werden. Kombinationstherapien ohne Valproat sind mit einem geringeren Fehlbildungsrisiko verbunden als früher angenommen.
- Für eine Schwangerschaft als besonders günstig belegte Wirkstoffe sind Lamotrigin, Levetiracetam, Carbamazepin und Oxcarbazepin, möglichst in niedrigen Tagesdosen.
- Auch medikamentös behandelte Frauen mit Epilepsie können ihre Kinder stillen, sollten aber mögliche unerwünschte Wirkungen wie Sedierung, Trinkschwäche oder fehlende Gewichtszunahme beim Kind beachten.
Mit einer guten Vorbereitung, regelmäßigen Kontrollen und einer individuellen Therapieanpassung steht einer erfolgreichen Schwangerschaft und einer gesunden Entwicklung des Kindes in den meisten Fällen nichts im Wege.
Prof. Dr. med. Martin Kurthen
Quellen
- Herzog AG: Disorders of reproduction in patients with epilepsy: Primary neurological mechanisms. Seizure 2008; 17: 101–110.
- Ottman R, et al.: Higher risk of seizures in offspring of mothers than of fathers with epilepsy. Am J Hum Genet 1988; 43(3): 257–264.
- Pennell PB, et al.: Fertility and birth outcomes in women with epilepsy seeking pregnancy. JAMA Neurol 2018 [E-Pub ahead of Print]
- Viale L, et al.: Epilepsy in pregnancy and reproductive outcomes: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2015; 386: 1845–1852.
- Harden CL, et al.: Management issues for women with epilepsy – Focus on pregnancy (an evidence-based review): I. Obstetrical complications and change in seizure frequency. Epilepsia 2009; 50(5): 1229–1236.
- Katz O, et al.: Pregnancy and perinatal outcome in epileptic women: a population-based study. J Matern Fetal Neonatal Med 2006; 19(1): 21–25.
- Helbig I, et al.: Primer Part I – The building blocks of epilepsy genetics. Epilepsia 2016; 57(6): 861–868.
- Pirker S: Frauen mit Epilepsie: 7 wichtige Aspekte. Klin Neurophysiol 2005; 43: 138–143.
- Vajda FJE, et al.: The outcomes of pregnancy in women with untreated epilepsy. Seizure 2015; 24: 77–81.
- Morrow J, et al.: Malformation risks of antiepileptic drugs in pregnancy: a prospective study from the UK Epilepsy and Pregnancy Register. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006; 77: 193–198.
- Tomson T, Battino D: Teratogenic effects of antiepileptic drugs. Lancet Neurol 2012; 11: 803–813.
- Meador K, et al.: Pregnancy outcomes in women with epilepsy: a systematic review and meta-analysis of published pregnancy registries and cohorts. Epilepsy Res 2008; 81(1): 1–13.
- Kaneko S, et al. Congenital malformations due to antiepileptic drugs. Epilepsy Res 1999; 33: 145–158.
- Hernandez-Diaz S, et al.: Comparative safety of antiepileptic drugs during pregnancy. Neurology 2012; 78: 1692–1699.
- Tomson T, et al. Comparative risk of major congenital malformations with eight different antiepileptic drugs: a prospective cohort study of the EURAP registry. Lancet Neurol 2018; 17: 530–538.
- Molgaard-Nielsen D, Hviid A: Newer-generation antiepileptic drugs and the risk of major birth defects. JAMA 2011; 305: 1996–2002.
- Nakane Y, et al. Multi-institutional study on the teratogenicity and fetal toxicity of antiepileptic drugs: a report of a collaborative study group in Japan. Epilepsia 1980; 21: 663–680.
- Vajda FJE, et al.: The teratogenic risk of antiepileptic drug polytherapy. Epilepsia 2010; 51(5): 805–810.
- Adab N, et al.: The longer term outcome of children born to mothers with epilepsy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004; 75: 1575–1583.
- Gaily E, et al.: Normal intelligence in children with prenatal exposure to carbamazepine. Neurology 2004; 62: 28–32.
- Meador KJ, et al.: Fetal antiepileptic drug exposure and cognitive outcomes at age 6 ys (NEAD study): a prospective observational study. Lancet Neurol 2013; 12: 244–252.
- Pennell PB: Pregnancy in women who have epilepsy. Neurol Clin 2004; 22: 799–820.
- Baker GA, et al.: IQ at 6 years after in utero exposure to antiepileptic drugs. Neurology 2015; 84: 382–390.
- Shallcross R, et al.: Child development following in utero exposure. Neurology 2011; 76: 383–389.
- Bromley RL, et al.: Early cognitive development in children born to women with epilepsy: A prospective report. Epilepsia 2010; 51(10): 2058–2065.
- Nadebaum C, et al.: Language-skills of school-aged children prenatally exposed to antiepileptic drugs. Neurology 2011; 76: 719–726.
- Roullet FI, et al. In utero exposure to valproic acid and autism – a current review of clinical and animal studies. Neurotoxicol Teratol 2013; 36: 47–56.
- Tomson T, et al.: Withdrawal of valproic acid treatment during pregnancy and seizure outcome: Oberservations from EURAP. Epilepsia 2016; 57(8): 173–177.
- Rauchenzauner M, et al.: Generalized tonic-clonic seizures and antiepileptic drugs during pregnancy – a matter of importance for the baby? J Neurol 2013 ; 260(2) : 484–488.
- Harden CL, et al.: Management issues for women with epilepsy – Focus on pregnancy (an evidence-based review): II. Teratogenesis and perinatal outcomes. Epilepsia 2009; 50(5): 1237–1246.
- Yerbi M, et al. Pregnancy complications and outcomes in a cohort of women with epilepsy. Epilepsia 1985; 26(6): 631–635.
- Tomson T, et al.: Antiepileptic drugs and intrauterine death: A prospective observational study from EURAP. Neurology 2015; 85(7): 580–588.
- Fried S, et al.: Malformation rates in children of women with untreated epilepsy: a meta-analysis. Drug Saf 2004; 27(3): 197–202.
- Janz D: Über das Risiko von Missbildungen und Entwicklungsstörungen bei Kindern von Eltern mit Epilepsie. Nervenarzt 1979; 50: 555–562.
- Harden CL, et al.: Management issues for women with epilepsy – Focus on pregnancy (an evidence-based review): III. Vitamin K, folic acid, blood levels, and breast-feeding. Epilepsia 2009; 50(5): 1247–1255.
- Asadi-Pooya AA: High dose folic acid supplementation in women with epilepsy: Are we sure it is safe? Seizure 2015; 27: 51–53.
- Ban L, et al.: Congenital anomalies in children of mothers taking antiepileptic drugs with and without periconceptional high dose folic acid use: A population-based cohort study. PloS 2015; 10(7) Jul 6: e0131130.
- Bjork M, et al.: Association of folic acid supplementation during pregnancy with the risk of autistic traits in children exposed to antiepileptic drugs in utero. JAMA Neurol 2018; 75(2): 160–168.
- Reimers A: New antiepileptic drugs and women. Seizure 2014; 23: 585–591.
- Tomson T, et al.: Antiepileptic drug treatment in pregnancy: Changes in drug disposition and their clinical implications. Epilepsia 2013; 54(3): 405–414.
- Schubiger G, et al.: Vitamin-K-Prophylaxe bei Neugeborenen: Neue Empfehlungen. Paediatrica 2002; 13(6): 54–55.
- Chen L, et al.: Is breast-feeding of infants advisable for epileptic mothers taking antiepileptic drugs? Psychiatry and Clinical Neurosciences 2010; 64: 460–468.
- Veiby G, et al.: Epilepsy and recommendations for breastfeeding. Seizure 2015; 28: 57–65.
- Van der Meer DH, et al.: Lactation studies of anticonvulsants: a quality review. Br J Clin Pharmacol 2014; 79(4): 558–565.
- Crettenand M, et al.: Antiepileptika in der Stillzeit. Nervenarzt 2018; [Epub ahead of print]
- Veiby G, et al.: Early child development and exposure to antiepileptic drugs prenatally and through breastfeeding. A prospective cohort study on children of women with epilepsy. JAMA Neurol 2013; 70(11): 1367–1374.
- Meador KJ, et al.: Breastfeeding in children of women taking antiepileptic drugs. JAMA Pediatr 2014; 168(8): 729–736.