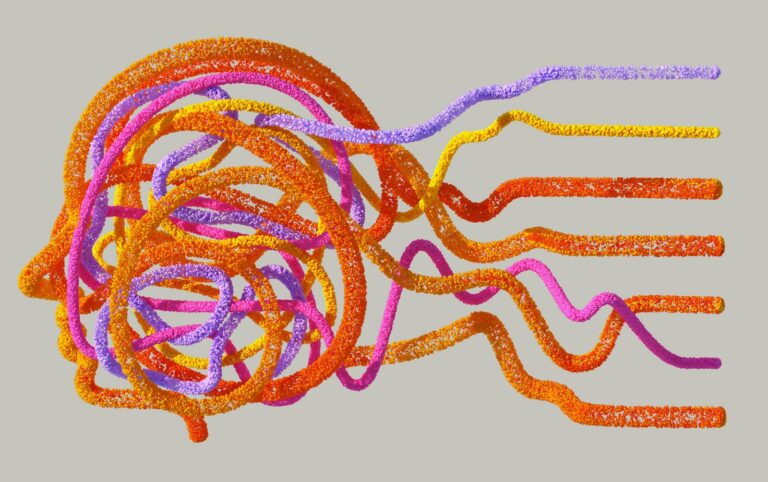Ein ischämischer Schlaganfall oder eine transitorische ischämische Attacke (TIA) kann das Leben grundlegend verändern. Umso wichtiger ist es, Rückfällen gezielt vorzubeugen. Dieser Artikel basiert auf aktuellen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) und der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) und erklärt, wie Sie gemeinsam mit Ihrem Behandlungsteam das Risiko für einen erneuten Schlaganfall senken können.
Warum ist die Sekundärprävention nach Schlaganfall oder TIA so wichtig?
Nach einem ischämischen Schlaganfall (eine Form des Schlaganfalls, bei der ein Blutgefäß im Gehirn durch ein Blutgerinnsel verstopft wird) oder einer transitorischen ischämischen Attacke (TIA, auch als “Mini-Schlaganfall” bezeichnet, bei dem die Symptome meist innerhalb von 24 Stunden wieder verschwinden) bleibt das Risiko für einen weiteren Schlaganfall deutlich erhöht. Statistiken zeigen, dass fast jeder fünfte Betroffene innerhalb von fünf Jahren einen erneuten Schlaganfall erleidet. Besonders hoch ist das Risiko in den ersten Tagen nach einer TIA. Deshalb ist es entscheidend, alle empfohlenen Maßnahmen zur Sekundärprävention (Vorbeugung von Rückfällen) konsequent umzusetzen. Die neue S2k-Leitlinie empfiehlt eine enge Zusammenarbeit zwischen Neurologen, Hausärzten und Patientinnen und Patienten, um die bestmögliche Vorsorge zu gewährleisten.
Die Sekundärprävention umfasst nicht nur die medikamentöse Behandlung der klassischen Risikofaktoren wie Bluthochdruck (Hypertonie) und erhöhte Blutfettwerte (Hypercholesterinämie), sondern auch die Berücksichtigung weiterer Faktoren wie Lebensstil, Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), Hormonersatztherapie und Schlafapnoe (Atemaussetzer während des Schlafs). Die umfassende Nachsorge ist entscheidend, um das Risiko für einen erneuten Schlaganfall zu minimieren und die Lebensqualität langfristig zu erhalten.
Gerinnungshemmung: Wann und wie ist sie sinnvoll?
Ein wichtiger Baustein der Schlaganfallprävention ist die sogenannte Gerinnungshemmung, also die gezielte Hemmung der Blutgerinnung, um die Bildung von Blutgerinnseln zu verhindern. Die Entscheidung, ob und welches gerinnungshemmende Medikament eingesetzt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter das individuelle Blutungsrisiko, Begleiterkrankungen (Komorbiditäten) und persönliche Risikofaktoren. Die S2k-Leitlinie gibt einen Rahmen vor, innerhalb dessen die Therapie individuell angepasst werden kann.
Zur Thrombozytenaggregationshemmung (Hemmung der Verklumpung von Blutplättchen, um Gerinnsel zu verhindern) werden in der Leitlinie ausschließlich Acetylsalicylsäure (ASS), Clopidogrel und Ticagrelor empfohlen. Andere Präparate werden nicht empfohlen, da sie entweder mehr Nebenwirkungen haben oder deren Nutzen nicht ausreichend belegt ist. Bei akzeptablem Blutungsrisiko kann bereits innerhalb der ersten 24 Stunden nach Symptombeginn eine kurzfristige doppelte Thrombozytenaggregationshemmung erfolgen: Entweder mit ASS und Clopidogrel für 21 Tage oder mit ASS und Ticagrelor für 30 Tage. Diese Kombinationstherapie senkt das Risiko für einen erneuten Schlaganfall in der Frühphase, sollte jedoch nicht länger als empfohlen durchgeführt werden, um das Blutungsrisiko nicht unnötig zu erhöhen.
Bei Patientinnen und Patienten mit Vorhofflimmern (eine häufige Herzrhythmusstörung, bei der das Herz unregelmäßig schlägt und sich dadurch leichter Gerinnsel bilden können) ist eine orale Antikoagulation (Einnahme von gerinnungshemmenden Tabletten) besonders wichtig. Hier werden sogenannte direkte orale Antikoagulanzien (DOAKs) bevorzugt, da sie das Risiko für einen erneuten Schlaganfall effektiv senken und im Vergleich zu älteren Medikamenten wie Warfarin oder Phenprocoumon ein geringeres Blutungsrisiko aufweisen.
Vorhofflimmern erkennen und gezielt behandeln
Vorhofflimmern ist eine der häufigsten Ursachen für ischämische Schlaganfälle. Betroffene haben ein vier- bis fünffach erhöhtes Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden. Die Leitlinie empfiehlt daher, bei allen Patientinnen und Patienten mit ischämischem Schlaganfall oder TIA gezielt nach Vorhofflimmern zu suchen und – falls dieses vorliegt – eine orale Antikoagulation einzuleiten. Dabei ist es unerheblich, ob das Vorhofflimmern dauerhaft (permanent), anhaltend (persistierend) oder anfallsweise (paroxysmal) auftritt.
Nach der Akutphase sollte bei Vorhofflimmern auf Thrombozytenaggregationshemmer verzichtet werden, sofern keine andere dringende Indikation besteht. Falls aus anderen Gründen bereits eine Thrombozytenaggregationshemmung erfolgt, sollte gemeinsam mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten entschieden werden, ob eine Kombinationstherapie notwendig ist. In besonderen Fällen, zum Beispiel bei Kontraindikationen gegen eine dauerhafte orale Antikoagulation oder bei erhöhtem Blutungsrisiko (etwa bei dialysepflichtigen Patientinnen und Patienten), kann eine sogenannte LAA-Okklusion (Verschluss des linken Vorhofohrs, wo sich bei Vorhofflimmern häufig Gerinnsel bilden) erwogen werden. Diese minimalinvasive Methode kann das Risiko für Schlaganfälle ebenfalls senken, wenn eine medikamentöse Therapie nicht möglich ist.
Blutdruck und Cholesterin: Werte gezielt senken
Ein dauerhaft gut eingestellter Blutdruck ist einer der wichtigsten Faktoren zur Vorbeugung eines erneuten Schlaganfalls. Nach einem Schlaganfall oder einer TIA sollte der Blutdruck langfristig unter 140/90 mm Hg liegen. Je nach Alter, Verträglichkeit der Medikamente und Begleiterkrankungen kann sogar eine Senkung auf systolisch 120 bis 130 mm Hg sinnvoll sein. Entscheidend ist, dass die Zielwerte erreicht werden – die Wahl des Medikaments ist dabei weniger wichtig als die konsequente Kontrolle der Werte.
Auch erhöhte Blutfettwerte (Dyslipidämie) spielen eine große Rolle bei der Entstehung von Gefäßverkalkungen (Atherosklerose) und damit bei der Entstehung von Schlaganfällen. Besonders das LDL-Cholesterin (das sogenannte “schlechte” Cholesterin) sollte unter 70 mg/dl gesenkt werden. Alternativ kann eine Reduktion um mehr als 50 Prozent des Ausgangswerts angestrebt werden. Die konsequente Senkung der Blutfettwerte trägt dazu bei, das Risiko für weitere Herz-Kreislauf-Erkrankungen (atherosklerotisch bedingte kardiovaskuläre Erkrankungen, ASCVD) und Schlaganfallrezidive deutlich zu reduzieren.
Lebensstil: Was Sie selbst tun können
Neben der medikamentösen Behandlung ist der Lebensstil ein entscheidender Faktor für die Schlaganfallprävention. Viele Risikofaktoren können durch eigenes Verhalten beeinflusst werden. Dazu gehören eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung, Verzicht auf Rauchen und ein maßvoller Umgang mit Alkohol. Eine mediterrane Ernährung, die reich an Obst, Gemüse, Olivenöl, Fisch und Vollkornprodukten ist, hat sich als besonders günstig erwiesen. Auch eine Reduktion des Salzkonsums kann helfen, den Blutdruck zu senken.
Für Nahrungsergänzungsmittel oder die routinemäßige Einnahme von Vitaminen gibt es laut Leitlinie keine eindeutigen Belege für einen Nutzen in der Schlaganfallprävention. Viel wichtiger ist die regelmäßige körperliche Aktivität – idealerweise mindestens 150 Minuten pro Woche in Form von moderatem Ausdauertraining wie zügigem Gehen, Radfahren oder Schwimmen. Auch kleine Veränderungen im Alltag, wie das Treppensteigen oder kurze Spaziergänge, können einen positiven Effekt haben.
Ein weiterer wichtiger Risikofaktor ist der Diabetes mellitus. Menschen mit Diabetes haben ein erhöhtes Risiko für Schlaganfälle. Nach einem Schlaganfall sollten Diabetiker besonders auf eine gute Blutzuckereinstellung achten. Für Menschen unter 65 Jahren wird ein HbA1c-Wert zwischen 6,5 und 7 % empfohlen, für Menschen über 65 Jahre ein Wert zwischen 6,5 und 7,5 %. Der HbA1c-Wert gibt an, wie hoch der durchschnittliche Blutzucker in den letzten zwei bis drei Monaten war.
Weitere Risikofaktoren: Schlafapnoe, Hormone und spezielle Situationen
Die Leitlinie geht auch auf weitere Risikofaktoren und besondere Situationen ein. So sollte gezielt nach einer Schlafapnoe gesucht werden, da nächtliche Atemaussetzer das Risiko für Schlaganfälle erhöhen. Bei mittelschwerer bis schwerer Schlafapnoe ist die nächtliche Überdruckbeatmung (CPAP-Therapie, eine Behandlung mit einer Atemmaske, die die Atemwege offen hält) die Therapie der Wahl.
Frauen, die nach einem Schlaganfall weiterhin hormonelle Verhütungsmittel (Kontrazeptiva) einnehmen, sollten gemeinsam mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin prüfen, ob eine Umstellung auf eine andere Verhütungsmethode sinnvoll ist. Auch die Hormonersatztherapie in den Wechseljahren sollte kritisch hinterfragt werden, da sie das Schlaganfallrisiko beeinflussen kann.
In speziellen Situationen, zum Beispiel bei Schlaganfällen im Zusammenhang mit einer Krebserkrankung (onkolytische Erkrankung) oder bei einer tumorinduzierten Hyperkoagulopathie (erhöhte Gerinnungsneigung durch Tumorerkrankung), kann eine orale Antikoagulation anstelle einer Thrombozytenfunktionshemmung in Erwägung gezogen werden. Auch bei Herzinsuffizienz mit einer Ejektionsfraktion unter 35 % kann dies sinnvoll sein. Bei Dissektionen (Einrisse in den hirnversorgenden Arterien) und intrakraniellen Gefäßstenosen (Verengungen der Hirngefäße) gibt es ebenfalls spezielle Therapieempfehlungen, die individuell mit dem Behandlungsteam besprochen werden sollten.
Fazit: Gemeinsam aktiv für Ihre Gesundheit
Die Sekundärprävention nach einem ischämischen Schlaganfall oder einer TIA ist ein komplexes, aber sehr wirkungsvolles Maßnahmenpaket. Sie umfasst die gezielte medikamentöse Behandlung, die Kontrolle von Blutdruck und Cholesterin, die Anpassung des Lebensstils sowie die Berücksichtigung weiterer individueller Risikofaktoren. Die enge Zusammenarbeit zwischen Patientinnen und Patienten, Hausärzten, Neurologen und weiteren Fachärzten ist entscheidend, um das Risiko für einen erneuten Schlaganfall zu senken und die Lebensqualität zu erhalten. Sprechen Sie offen mit Ihrem Behandlungsteam über Ihre Fragen und Sorgen – gemeinsam können Sie viel für Ihre Gesundheit tun.
Quellen
- Stahmeyer JT, et al.: Häufigkeit und Zeitpunkt von Rezidiven nach inzidentem Schlaganfall. Eine Analyse auf Basis von GKV-Routinedaten. The frequency and timing of recurrent stroke – an analysis of routine health insurance data. Dtsch Arztebl Int 2019; 116: 711–717.
- Hamann GF, et al.: Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft und Deutsche Gesellschaft für Neurologie. Sekundärprophylaxe ischämischer Schlaganfall und transitorische ischämische Attacke: Teil 1, S2k-Leitlinie, 2022, https://dgn.org/leitlinien/ll-030-133-sekundarprophylaxe-ischamischer-schlaganfall-und-transitorische-ischamische-attacke-teil-1, (letzter Abruf, 23.11.2022)
- Olma MC, et al.: Sekundärprophylaxe ischämischer Schlaganfall und transitorische ischämische Attacke – Teil 2, S2k-Leitlinie, 2022, Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) und Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft (DSG), https://dgn.org/leitlinien/ll-030-143-sekundarprophylaxe-ischamischer-schlaganfall-und-transitorische-ischamische-attacke-teil-2 (letzter Abruf, 23.11.2022)
- «Neue Leitlinie der DGN und der DSG zur Sekundärprävention von Schlaganfällen», Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN), 04.07.2022.
- Diener HC, et al.: Dabigatran compared with warfarin in patients with atrial fibrillation and previous transient ischaemic attack or stroke: a subgroup analysis of the RE-LY trial. Lancet Neurol 2010; 9(12): 1157–1163.
- Easton JD, et al.: Apixaban compared with warfarin in patients with atrial fibrillation and previous stroke or transient ischaemic attack: a subgroup analysis of the ARISTOTLE trial. Lancet Neurol 2012; 11(6): 503–511.
- Hankey GJ, et al.: Rivaroxaban compared with warfarin in patients with atrial fibrillation and previous stroke or transient ischaemic attack: a subgroup analysis of ROCKET AF. Lancet Neurol 2012; 11(4): 315–322.
- Rost NS, et al.: Outcomes With Edoxaban Versus Warfarin in Patients With Previous Cerebrovascular Events: Findings From ENGAGE AF-TIMI 48 (Effective Anticoagulation With Factor Xa Next Generation in Atrial Fibrillation-Thrombolysis in Myocardial Infarction 48). Stroke 2016; 47(8): 2075–2082.
- Zonneveld TP, et al.: Blood pressure-lowering treatment for preventing recurrent stroke, major vascular events, and dementia in patients with a history of stroke or transient ischaemic attack. Cochrane Database Syst Rev 2018 Jul 19;7(7): CD007858. doi: 10.1002/14651858.CD007858.pub2.