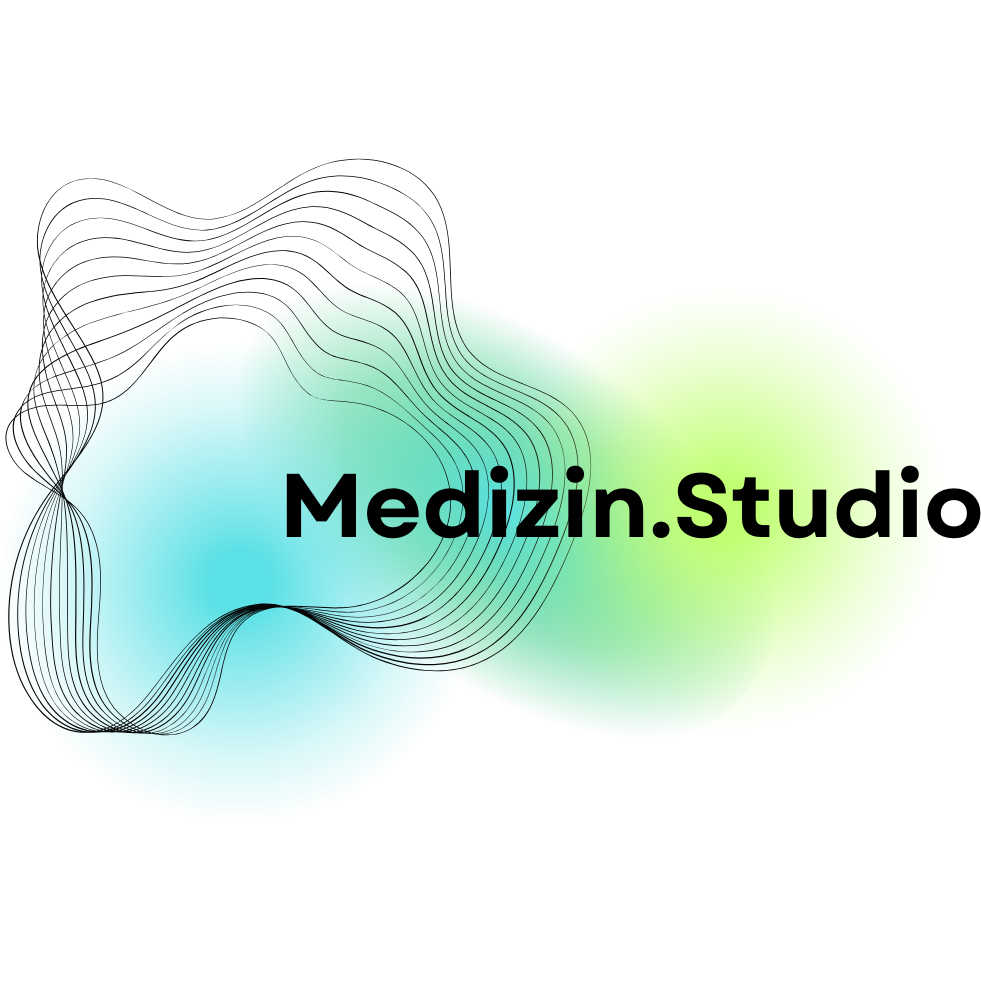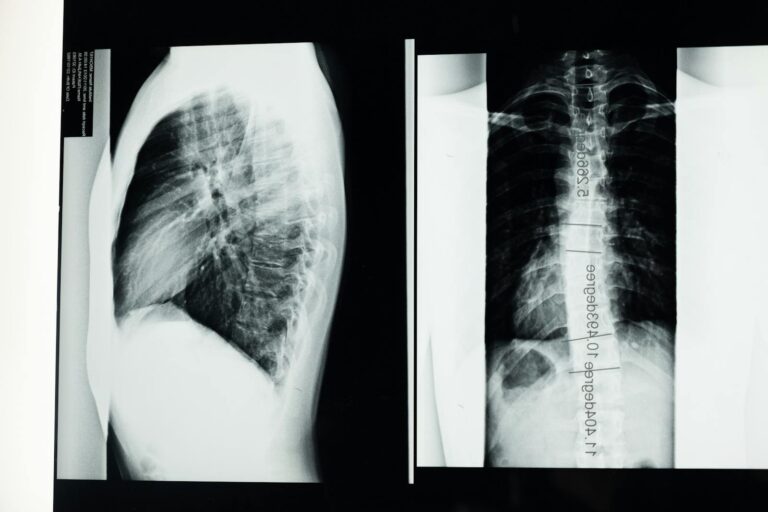Die Herzbildgebung hat unser Verständnis der koronaren Herzkrankheit (KHK) entscheidend verbessert und ist heute ein zentrales Element in der Diagnostik und Behandlung. In diesem Artikel, der auf CARDIOVASC basiert, erfahren Sie, welche bildgebenden Verfahren es gibt, wie sie eingesetzt werden, welche Vor- und Nachteile sie haben und was Patienten mit Verdacht auf KHK wissen sollten.
Thorakale Beschwerden und die Rolle der Herzbildgebung
Viele Menschen suchen wegen Brustschmerzen (medizinisch: thorakale Beschwerden) ihren Hausarzt auf. In der Schweiz sind etwa 3 % aller Arztbesuche auf solche Beschwerden zurückzuführen. Die Ursachen reichen von harmlosen (benignen) Problemen bis hin zu lebensbedrohlichen Erkrankungen wie der koronaren Herzkrankheit (KHK), bei der die Herzkranzgefäße verengt oder blockiert sind. Besonders die KHK ist gefürchtet, da sie zu Herzinfarkt, Herzschwäche und sogar zum plötzlichen Herztod führen kann. Deshalb ist eine genaue und möglichst schonende Diagnostik wichtig. Moderne bildgebende Verfahren, also Methoden, die das Herz sichtbar machen, haben sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Sie helfen Ärzten, die Ursache der Beschwerden besser einzugrenzen und die richtige Behandlung zu wählen.
Die Auswahl der passenden Bildgebung hängt von verschiedenen Faktoren ab: Welche Frage soll beantwortet werden? Welche Risiken und Kosten sind mit dem Verfahren verbunden? Und wie sieht die individuelle Situation des Patienten aus? Es ist wichtig, dass die Vorteile einer Untersuchung immer gegen mögliche Risiken und Kosten abgewogen werden. Gerade bei der KHK, die oft schleichend verläuft und erst spät Beschwerden macht, ist das Ziel, möglichst früh und sicher eine Diagnose zu stellen – und das möglichst ohne belastende Eingriffe.
Die Nachfrage nach nicht-invasiven (also ohne Eingriff in den Körper) und gleichzeitig zuverlässigen Methoden ist groß. Dank technischer Fortschritte stehen heute verschiedene Verfahren zur Verfügung, die sich in ihrer Aussagekraft, Sicherheit und Anwendbarkeit unterscheiden. Im Folgenden stellen wir die wichtigsten bildgebenden Methoden vor, die bei Verdacht auf KHK eingesetzt werden.
Die wichtigsten bildgebenden Verfahren im Überblick
Stress-Echokardiografie: Die Stress-Echokardiografie ist ein Ultraschallverfahren, bei dem das Herz unter Belastung untersucht wird. Ziel ist es, sogenannte Ischämie-induzierte Wandbewegungsstörungen zu erkennen – das sind Bewegungsauffälligkeiten des Herzmuskels, die durch eine Minderdurchblutung (Ischämie) entstehen. Die Belastung kann entweder durch körperliche Aktivität oder durch Medikamente wie Dobutamin erzeugt werden. Mit Dobutamin lässt sich zusätzlich die Viabilität (Lebensfähigkeit) des Herzmuskels beurteilen. Neue Techniken wie das Strain Imaging (Messung der Dehnbarkeit des Herzmuskels) und die 3D-Echokardiografie verbessern die Genauigkeit weiter. Allerdings hängt die Aussagekraft stark von der Erfahrung des Untersuchers und der Bildqualität ab. Bei Patienten mit Übergewicht (Adipositas), Lungenemphysem (chronische Lungenerkrankung) oder Trichterbrust kann die Bildqualität eingeschränkt sein.
Herz-CT: Die Herz-Computertomografie (Herz-CT) ermöglicht eine detaillierte Darstellung der Herzkranzgefäße (Koronarien) und der Herzstruktur. Sie liefert ähnliche Informationen wie die invasive Koronarangiografie, bei der ein Katheter in die Gefäße eingeführt wird. Besonders geeignet ist das Herz-CT, um eine KHK bei Patienten mit niedriger bis mittlerer Vortestwahrscheinlichkeit auszuschließen. Die Methode hat eine sehr hohe Sensitivität (Fähigkeit, eine Erkrankung zu erkennen) und einen nahezu perfekten negativen prädiktiven Wert (wenn das Ergebnis unauffällig ist, ist eine KHK sehr unwahrscheinlich). Die Spezifität (Fähigkeit, Gesunde richtig zu erkennen) ist jedoch nur moderat, da das CT manchmal den Grad der Gefäßverengung überschätzt. Studien und große Register haben gezeigt, dass das Herz-CT auch eine wichtige Rolle für die Prognoseabschätzung spielt.
In den letzten Jahren hat sich die Technik rasant weiterentwickelt. Heute können hochauflösende Bilder mit sehr niedriger Strahlenbelastung aufgenommen werden. Die durchschnittliche Strahlenbelastung liegt bei 2–5 Millisievert (mSv), in spezialisierten Zentren sogar oft unter 1 mSv. Trotzdem ist eine sorgfältige Patientenauswahl wichtig: Bei ausgeprägten Herzrhythmusstörungen (Arrhythmien) kann die Bildqualität eingeschränkt sein. Außerdem gibt es Kontraindikationen (Gegenanzeigen) für das verwendete Kontrastmittel, zum Beispiel bei Jodallergie oder schwerer Niereninsuffizienz (eingeschränkte Nierenfunktion).
Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT): Die Myokardperfusions-SPECT ist ein nuklearmedizinisches Verfahren, das die Durchblutung des Herzmuskels sichtbar macht. Hierbei werden radioaktive Tracer (meist 99m-Technetium-basierte Substanzen wie Sestamibi oder Tetrofosmin) in die Blutbahn gespritzt. Diese lagern sich in durchbluteten Herzmuskelzellen (viable Myozyten) an. Die beim Zerfall entstehende γ-Strahlung wird von speziellen Kameras aufgefangen und in Bilder umgewandelt. Moderne Detektoren ermöglichen eine gute Bildqualität bei gleichzeitig niedriger Strahlenbelastung (2–5 mSv). Die Belastung kann durch körperliche Aktivität oder Medikamente wie Dobutamin oder Adenosin erfolgen.
Mit der SPECT lassen sich sowohl Durchblutungsstörungen (Ischämie) als auch Narben im Herzmuskel (Myokardnarben) erkennen. Das Verfahren hat eine hohe diagnostische Genauigkeit und liefert zusätzlich Informationen über die Funktion des linken Ventrikels (Hauptkammer des Herzens), wenn das EKG mitgetriggert wird. Für die SPECT gibt es umfangreiche Daten aus großen Patientenkollektiven, die auch den prognostischen Wert (Vorhersagekraft für den weiteren Verlauf) belegen. Das macht die Methode besonders wertvoll für die Risikoabschätzung bei KHK.
Positronenemissionstomografie (PET): Die PET ist ebenfalls ein nuklearmedizinisches Verfahren, unterscheidet sich aber von der SPECT durch die verwendeten Radionuklide und die Technik der Bildaufnahme. Während bei der SPECT Radionuklide mit γ-Zerfall und längerer Halbwertszeit (z. B. 6 Stunden für 99m-Technetium) eingesetzt werden, nutzt die PET Radionuklide mit β+-Zerfall und sehr kurzer Halbwertszeit (z. B. 10 Minuten für 13N-Ammoniak). Die Herstellung dieser Substanzen erfordert meist ein Zyklotron (Teilchenbeschleuniger) vor Ort, mit Ausnahme von 82Rubidium, das mit einem Generator produziert werden kann.
Die PET bietet eine deutlich bessere Bildauflösung als die SPECT und ist weniger anfällig für Störungen durch Weichteile (robustere Schwächungskorrektur). Sie gilt daher als die bildgebende Methode mit der höchsten diagnostischen Wertigkeit bei der KHK. Ein besonderer Vorteil ist die Möglichkeit, den myokardialen Blutfluss absolut zu quantifizieren (in ml/min/g Herzmuskelgewebe). Das hilft, auch sogenannte balancierte Dreigefäßerkrankungen (gleichmäßige Durchblutungsstörung in allen drei Hauptgefäßen) oder Störungen der Mikrozirkulation (kleinste Gefäße) zu erkennen. Die Strahlenbelastung bei einer 13N-Ammoniak-PET liegt bei 1–3 mSv. Mehrere große Studien belegen auch den prognostischen Wert der PET.
Magnetresonanztomografie (MRT): Die Herz-MRT ist ein Verfahren ohne Strahlenbelastung, das mit starken Magnetfeldern und Radiowellen arbeitet. Sie liefert exzellente Bilder von Herzstruktur und -funktion. Durch die Gabe von gadoliniumhaltigem Kontrastmittel kann die Durchblutung des Herzmuskels sowohl in Ruhe als auch unter Belastung (meist durch Adenosin) beurteilt werden. Die diagnostische Genauigkeit ist sehr gut. Wird Dobutamin als Stressmittel eingesetzt, lassen sich zusätzlich Wandbewegungsstörungen erkennen. Mit dem sogenannten Late-Gadolinium-Enhancement (LGE) kann das Gewebe charakterisiert werden, insbesondere Narben nach einem Infarkt oder noch lebensfähiger Herzmuskel (viables Myokard). Kontraindikationen sind vor allem Metallimplantate (z. B. viele Schrittmacher oder Defibrillatoren), schwere Niereninsuffizienz und ausgeprägte Platzangst (Klaustrophobie). Auch Herzrhythmusstörungen und Probleme beim Atemanhalten können die Bildqualität beeinträchtigen.
Hybridbildgebung: Die Hybridbildgebung kombiniert verschiedene bildgebende Verfahren, zum Beispiel die anatomische Information aus der Herz-CT mit der funktionellen Information aus der Myokardperfusions-SPECT oder -PET. Dadurch können Ärzte gleichzeitig den Schweregrad einer Gefäßverengung (Stenose) und deren Bedeutung für die Durchblutung (hämodynamische Relevanz) beurteilen. Auch das betroffene Versorgungsgebiet lässt sich genau darstellen. Studien zeigen, dass die Hybridbildgebung oft eine höhere diagnostische Genauigkeit und einen besseren prognostischen Wert hat als die Einzelverfahren. Sie wird vor allem in spezialisierten Zentren eingesetzt.
Individuelle Auswahl der Bildgebung: Vortestwahrscheinlichkeit und Bayes-Theorem
Die Wahl des optimalen bildgebenden Verfahrens hängt von der sogenannten Vortestwahrscheinlichkeit ab – also davon, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Patient tatsächlich eine KHK hat, bevor überhaupt eine Untersuchung durchgeführt wird. Hier kommt das Bayes’sche Theorem ins Spiel: Es beschreibt, wie die Aussagekraft eines Testergebnisses von der Vortestwahrscheinlichkeit beeinflusst wird. Sensitivität (Erkennungsrate von Kranken) und Spezifität (Erkennungsrate von Gesunden) sind wichtige Kennzahlen, reichen aber allein nicht aus, um die Aussagekraft im Alltag zu beurteilen.
Bei Patienten mit sehr niedriger Vortestwahrscheinlichkeit sind auffällige Testergebnisse häufig falsch positiv, das heißt, sie zeigen eine Erkrankung an, die gar nicht vorliegt. Umgekehrt können bei sehr hoher Vortestwahrscheinlichkeit normale Testergebnisse falsch negativ sein, also eine bestehende Erkrankung übersehen. Der größte Nutzen der bildgebenden Verfahren liegt daher bei Patienten mit mittlerer Vortestwahrscheinlichkeit (etwa 15–85 %). Das sind zum Beispiel Menschen mit atypischer Angina pectoris (Brustschmerzen, die nicht alle typischen Merkmale erfüllen) oder Frauen mittleren Alters mit typischer Angina. Für diese Gruppen empfehlen die aktuellen Leitlinien eine primär nicht-invasive bildgebende Abklärung.
Die individuelle Auswahl des Verfahrens richtet sich nach den klinischen Merkmalen des Patienten, den Begleiterkrankungen (Komorbiditäten) und der verfügbaren lokalen Expertise. So kann bei bestimmten Fragestellungen und Patientengruppen das eine oder andere Verfahren besser geeignet sein. Wichtig ist, dass die Untersuchung nicht nur technisch möglich, sondern auch sinnvoll und sicher für den Patienten ist.
Vergleich der Methoden und aktuelle Empfehlungen
Der direkte Vergleich der verschiedenen bildgebenden Verfahren ist nicht immer einfach, da sie unterschiedliche Aspekte der KHK abbilden. So beurteilt das Herz-CT vor allem die Anatomie der Gefäße, die Stress-Echokardiografie die Wandbewegung des Herzmuskels und SPECT, PET oder MRT die Durchblutung (Perfusion). Auch die Erfahrung des jeweiligen Zentrums mit einer Methode spielt eine Rolle. Deshalb schwanken die Angaben zu Sensitivität und Spezifität in der Literatur zum Teil erheblich.
Einzelne Studien deuten darauf hin, dass bestimmte Verfahren in bestimmten Situationen überlegen sein könnten. Insgesamt zeigen aber große, zusammengefasste Datenauswertungen, dass die Unterschiede zwischen den Methoden in der Praxis oft kleiner sind als angenommen. Einigkeit besteht darüber, dass die bildgebenden Verfahren dem klassischen Belastungs-EKG in der Diagnostik überlegen sind. Deshalb empfehlen die Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC), wann immer möglich, eine bildgebende Untersuchung vorzuziehen.
Die ESC-Leitlinien geben einen klaren Fahrplan für die Abklärung bei Verdacht auf KHK vor. Dabei spielt die differenzielle Auswahl der Bildgebung eine besonders wichtige Rolle. Die Wahl des Verfahrens sollte sich immer an der individuellen Fragestellung, den Patientenmerkmalen und der lokalen Expertise orientieren. Eine Übersichtstabelle kann Ärzten und Patienten helfen, die richtige Methode auszuwählen.
Die Kosten der einzelnen Verfahren, die Strahlenbelastung und mögliche Risiken (zum Beispiel allergische Reaktionen auf Kontrastmittel oder Probleme bei Niereninsuffizienz) müssen immer mitbedacht werden. In spezialisierten Zentren können viele Untersuchungen heute mit sehr niedriger Strahlenbelastung durchgeführt werden. Dennoch sollte jede Untersuchung nur dann erfolgen, wenn sie einen klaren Nutzen für die Diagnose oder Therapieentscheidung bringt.
Praktische Hinweise für Patienten: Was Sie wissen sollten
Für Patienten mit Verdacht auf KHK ist es wichtig zu wissen, dass die Herzbildgebung heute sehr viele Möglichkeiten bietet, die Erkrankung frühzeitig und sicher zu erkennen oder auszuschließen. Die Wahl des Verfahrens wird individuell getroffen und hängt von Ihren Beschwerden, Vorerkrankungen und der Einschätzung Ihres Arztes ab. Nicht jede Methode ist für jeden Patienten geeignet. Ihr Arzt wird mit Ihnen besprechen, welches Verfahren in Ihrer Situation am sinnvollsten ist.
Die Stress-Echokardiografie ist besonders geeignet, wenn die Belastbarkeit des Herzens und die Beweglichkeit des Herzmuskels beurteilt werden sollen. Das Herz-CT ist ideal, um die Herzkranzgefäße darzustellen und eine KHK auszuschließen, vor allem bei Patienten mit niedrigem bis mittlerem Risiko. Die SPECT und PET sind wertvoll, wenn es um die Beurteilung der Durchblutung und die Risikoabschätzung geht. Die MRT bietet eine strahlenfreie Alternative mit sehr guter Bildqualität, ist aber nicht für alle Patienten möglich (z. B. bei bestimmten Implantaten oder schwerer Niereninsuffizienz).
Vor jeder Untersuchung wird Ihr Arzt Sie über den Ablauf, mögliche Risiken und die zu erwartende Aussagekraft informieren. Scheuen Sie sich nicht, Fragen zu stellen – Ihr Verständnis ist ein wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Diagnostik und Behandlung. In spezialisierten Zentren stehen oft mehrere Verfahren zur Verfügung, sodass die Untersuchung optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden kann.
Die Hybridbildgebung wird meist in spezialisierten Kliniken eingesetzt und kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn eine besonders genaue Beurteilung der Gefäßverengungen und ihrer Bedeutung für die Durchblutung nötig ist. Sie kann helfen, unnötige invasive Eingriffe zu vermeiden und die Therapie gezielt zu steuern.
Wichtig ist, dass die Bildgebung immer Teil eines Gesamtkonzepts ist. Sie ersetzt nicht das ärztliche Gespräch, die körperliche Untersuchung und andere wichtige Tests (wie Blutuntersuchungen oder das EKG), sondern ergänzt diese sinnvoll. Ihr Arzt wird alle Ergebnisse gemeinsam mit Ihnen besprechen und die nächsten Schritte planen.
Zusammenfassung: Die wichtigsten Erkenntnisse zur Herzbildgebung bei KHK
Die Herzbildgebung ist heute ein unverzichtbarer Bestandteil der Diagnostik und Behandlung der koronaren Herzkrankheit. Sie hat dazu beigetragen, die Erkrankung besser zu verstehen und Patienten gezielter zu behandeln. Die aktuellen Leitlinien empfehlen bei stabilen Patienten mit Verdacht auf KHK eine nicht-invasive Bildgebung, sofern die nötige Erfahrung und Technik vor Ort vorhanden ist.
Die Auswahl des passenden Verfahrens sollte immer individuell erfolgen und die Vorteile gegen mögliche Risiken und Kosten abgewogen werden. Moderne Techniken ermöglichen heute eine sehr genaue Diagnostik bei gleichzeitig niedriger Strahlenbelastung und hoher Sicherheit. Die verschiedenen Methoden – Stress-Echokardiografie, Herz-CT, SPECT, PET, MRT und Hybridbildgebung – haben jeweils spezielle Stärken und Einschränkungen. Ihr Arzt wird gemeinsam mit Ihnen entscheiden, welches Verfahren für Sie am besten geeignet ist.
Die Bildgebung kann helfen, eine KHK sicher auszuschließen, das Risiko für Komplikationen einzuschätzen und die beste Therapie zu wählen. Sie ist jedoch immer Teil eines umfassenden diagnostischen und therapeutischen Gesamtkonzepts. Sprechen Sie offen mit Ihrem Arzt über Ihre Beschwerden, Ängste und Erwartungen – so kann die Diagnostik optimal auf Sie abgestimmt werden.
Abschließend gilt: Die Herzbildgebung ist ein mächtiges Werkzeug, das – richtig eingesetzt – dazu beiträgt, Ihre Herzgesundheit zu schützen und Ihnen die bestmögliche Behandlung zu ermöglichen.
PD Dr. med. Ronny R. Buechel, MD
Quellen
- Verdon F, et al.: Chest pain in daily practice: occurrence, causes and management. Swiss Med Wkly 2008; 138: 340–347.
- Fazel R, et al.: Exposure to low-dose ionizing radiation from medical imaging procedures. N Engl J Med 2009; 361: 849–857.
- Sicari R, et al.: Stress echocardiography expert consensus statement: European Association of Echocardiography (EAE) (a registered branch of the ESC). Eur J Echocardiogr 2008; 9: 415–437.
- Meijboom WB, et al.: Diagnostic accuracy of 64-slice computed tomography coronary angiography: a prospective, multicenter, multivendor study. J Am Coll Cardiol 2008; 52: 2135–2144.
- Budoff MJ, et al.: Diagnostic performance of 64-multidetector row coronary computed tomographic angiography for evaluation of coronary artery stenosis in individuals without known coronary artery disease: results from the prospective multicenter ACCURACY (Assessment by Coronary Computed Tomographic Angiography of Individuals Undergoing Invasive Coronary Angiography) trial. J Am Coll Cardiol 2008; 52: 1724–1732.
- Min JK, et al.: Age- and sex-related differences in all-cause mortality risk based on coronary computed tomography angiography findings results from the International Multicenter CONFIRM (Coronary CT Angiography Evaluation for Clinical Outcomes: An International Multicenter Registry) of 23,854 patients without known coronary artery disease. J Am Coll Cardiol 2011; 58: 849–860.
- Buechel RR, et al.: Low-dose computed tomography coronary angiography with prospective electrocardiogram triggering: feasibility in a large population. J Am Coll Cardiol 2011; 57: 332–336.
- Benz DC, et al.: Minimized Radiation and Contrast Agent Exposure for Coronary Computed Tomography Angiography: First Clinical Experience on a Latest Generation 256-slice Scanner. Acad Radiol 2016; 23: 1008–1014.
- Acampa W, Buechel RR, Gimelli A: Low dose in nuclear cardiology: state of the art in the era of new cadmium-zinc-telluride cameras. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2016; 17(6): 591–595.
- Verberne HJ, et al.: EANM procedural guidelines for radionuclide myocardial perfusion imaging with SPECT and SPECT/CT: 2015 revision. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2015; 42: 1929–1940.
- Shaw LJ, Iskandrian AE: Prognostic value of gated myocardial perfusion SPECT. J Nucl Cardiol 2004; 11: 171–185.
- Hachamovitch R, et al.: Impact of ischaemia and scar on the therapeutic benefit derived from myocardial revascularization vs. medical therapy among patients undergoing stress-rest myocardial perfusion scintigraphy. Eur Heart J 2011; 32: 1012–1024.
- Montalescot G, et al.: 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: the Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2013; 34: 2949–3003.
- Fiechter M, et al.: Diagnostic value of 13N-ammonia myocardial perfusion PET: added value of myocardial flow reserve. J Nucl Med 2012; 53: 1230–1234.
- Murthy VL, et al.: Improved cardiac risk assessment with noninvasive measures of coronary flow reserve. Circulation 2011; 124: 2215–2224.
- Dorbala S, et al.: Prognostic value of stress myocardial perfusion positron emission tomography: results from a multicenter observational registry. J Am Coll Cardiol 2013; 61: 176–184.
- Taqueti VR, et al.: Global coronary flow reserve is associated with adverse cardiovascular events independently of luminal angiographic severity and modifies the effect of early revascularization. Circulation 2015; 131: 19–27.
- Schwitter J, et al.: MR-IMPACT: comparison of perfusion-cardiac magnetic resonance with single-photon emission computed tomography for the detection of coronary artery disease in a multicentre, multivendor, randomized trial. Eur Heart J 2008; 29: 480–489.
- Gaemperli O, Bengel FM, Kaufmann PA: Cardiac hybrid imaging. Eur Heart J 2011; 32: 2100–2108.
- van Werkhoven JM, et al.: Prognostic value of multislice computed tomography and gated single-photon emission computed tomography in patients with suspected coronary artery disease. J Am Coll Cardiol 2009; 53: 623–632.
- Pazhenkottil AP, et al.: Prognostic value of cardiac hybrid imaging integrating single-photon emission computed tomography with coronary computed tomography angiography. Eur Heart J 2011; 32: 1465–1471.
- Schwitter J, et al.: MR-IMPACT II: Magnetic Resonance Imaging for Myocardial Perfusion Assessment in Coronary artery disease Trial: perfusion-cardiac magnetic resonance vs. single-photon emission computed tomography for the detection of coronary artery disease: a comparative multicentre, multivendor trial. Eur Heart J 2013; 34: 775–781.
- Greenwood JP, et al.: Comparison of cardiovascular magnetic resonance and single-photon emission computed tomography in women with suspected coronary artery disease from the Clinical Evaluation of Magnetic Resonance Imaging in Coronary Heart Disease (CE-MARC) Trial. Circulation 2014; 129: 1129–1138.
- Jaarsma C, et al.: Diagnostic performance of noninvasive myocardial perfusion imaging using single-photon emission computed tomography, cardiac magnetic resonance, and positron emission tomography imaging for the detection of obstructive coronary artery disease: a meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2012; 59: 1719–1728.
- Greenwood JP, et al.: Effect of Care Guided by Cardiovascular Magnetic Resonance, Myocardial Perfusion Scintigraphy, or NICE Guidelines on Subsequent Unnecessary Angiography Rates: The CE-MARC 2 Randomized Clinical Trial. JAMA 2016; 316: 1051–1060.